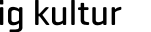Linz in Einkaufstüten
Eine Antwort auf so genannte Struktur- und Standortkrisen lautet vielfach Aufwertung mittels Kaufkraft in Kombination mit „Kultur“. Dies bedeutet, dass der Attraktivitätsfaktor einer Stadt mit seiner kulturellen Repräsentationsfähigkeit steigt und dazu beiträgt, den Konsum und die TouristenInnenströme in die Stadt zu lenken. So bemüht sich Linz schon seit den 1970ern, die Metamorphose von der Stahlstadt zur Kulturstadt zu vollziehen.
2002 lancierte die österreichische Werbewirtschaft eine landesweite Kampagne mit dem Slogan „Weniger raunzen, mehr Chancen“, um, angesichts der Konjunkturflaute, „gerade in schlechten Zeiten (...) positive Signale“ zu setzen, wie es der damalige Präsident der International Advertising Association Austria (IAA) formulierte. Auf deren Initiative hin wurde mittels TV-, Hörfunkspots, Plakaten, Infoscreens, Aufklebern und Bierdeckeln Österreich zur „Nichtraunzerzone“ erklärt. Die hiesige „Neigung zum Raunzen“ sollte damit ironisch auf’s Korn genommen und die Bevölkerung „zum Nachdenken“ angeregt werden, um so das „Meinungsklima“ mittelfristig zu verbessern – so das Ziel der Kampagne. Etwas weniger subtil zeigte sich die Werbeinitiative der Baufachmarkt-Kette Zgonc. Mit kreativer Klarheit sollte deren Slogan die Kundschaft in die Filialen locken: „Raunz ned, kauf!“. Anstatt der eigenen Unzufriedenheit – murrend, nörgelnd, motzend, quengelnd, mäkelnd, meckernd, raunzend – Ausdruck zu verleihen und womöglich das System (an) zu klagen, galt also: Shoppen für den Aufschwung.
Apropos Aufschwung: Die doppelte Antwort auf so genannte Struktur- und Standortkrisen lautet vielfach Aufwertung mittels Kaufkraft in Kombination mit „Kultur“. Dies bedeutet, dass der Attraktivitätsfaktor einer Stadt mit seiner kulturellen Repräsentationsfähigkeit steigt und dazu beiträgt, den Konsum und die TouristenInnenströme in die Stadt zu lenken. So bemüht sich Linz schon seit den 1970ern, die Metamorphose von der Stahlstadt zur Kulturstadt zu vollziehen. Insbesondere kulturelle Großprojekte entwickeln hierbei identitätsstiftende Wirkungsweisen und fungieren als Katalysatoren. Wenn etwa Linz Kulturhauptstadt 2009 als „wirtschaftlich und touristisch weiter verwertbares Standortentwicklungsprojekt“ begriffen wird, ist „Kultur wieder einmal nur Trägermedium, nur die Verpackung für andere Ziele“[1]. Die breite und schon früh formulierte Kritik an der Kulturhauptstadt, ihrer Vereinnahmungspolitik und Verwertungslogik (siehe z.B. das Positionspapier „Hülle ohne Inhalt“ von 2004), insbesondere aus der freien Kulturszene Oberösterreichs, ist bekannt. Die Rolle der Kulturschaffenden ist bei solchen kulturellen Mega-Events erfahrungsgemäß ambivalent: „Denn während die kulturelle Vision einerseits Raum und Kapital mobilisiert, um kulturelle Arbeit als gesellschaftliche Arbeit überhaupt wertzuschätzen und auszuzahlen, gliedert sie andererseits diese kulturelle Arbeit tendenziell in herrschaftliche Repräsentationspolitik ein.“[2]
Apropos Repräsentationspolitik: Mit dem Abbruch und der Rücknahme des Projekts „Linz in Torten“ des Vereins maiz, dem autonomen Zentrum von & für Migrantinnen, für Linz’09 ist die ohnehin sehr dünn gesäte Beteiligung von Migrant_innen an der Kulturhauptstadt weiter gesunken.[3] Einmal mehr stellt sich angesichts solcher erzwungenen Absagen die Frage, unter welchen Bedingungen migrantische Organisationen hierzulande prozessorientierte Kulturarbeit leisten (können) – und wie das neoliberale Vokabular die – angesichts der Streichung bzw. Kürzung von Förderungen und der an Projekte gebundenen Fördergelder, die an Stelle von Strukturförderung treten – erschwerten Konditionen für kritische Kulturschaffende umcodiert: Das Einlassen auf schlechte Vertragsbedingungen, nicht selten herbei geführt durch erfolgreiche Zermürbungstaktik seitens der FördergeberInnen, und das nunmehr eigenverantwortliche Handling prekärer Arbeitsverhältnisse gelten als „risikobereit, „arbeitswillig“, ja „professionell“. Letzteres bemängelte Linz’09 übrigens auffallend häufig bei abgebrochenen Projekten.
„La vie, la santé, l’amour sont précaires. Pourquoi le travail échapperait-il à cette loi?“[4], bemerkte Laurence Parisot, Präsidentin des Unternehmerverbands Mouvement des entreprises de France (MEDEF), anlässlich des 2006 eingeführten Arbeitsgesetzes „Contrat Première Embauche“ (das kurz darauf wieder von der französischen Regierung unter dem Druck landesweiter Proteste zurückgenommen wurde). Ihre Aussage lässt sich nahtlos in die herrschende Kulturpolitik übertragen und unterstreicht jene neoliberale Logik, die den gegenwärtigen Arbeitsverhältnissen im kulturellen Feld längst inne wohnt.
Zugegeben, solche Nachrichten haben wenig Neuigkeitswert. Also wieder mal Raunzerei aus dem Migrantinnen-Eck? Da erscheint es geradezu zynisch, dass die Eingangs erwähnte IAA laut Eigenbeschreibung die legendäre, aufsehenerregende antirassistische „Kolaric“-Plakatkampagne von 1973 („I haaß Kolaric, du haaßt Kolaric. Warum sogns’ zu dir Tschusch?“) zum Vorbild für die Austreibung des heimischen Nörglertums nahm.
Apropos Raunzen: Angesichts von Selbstmarketing, Work-Life-Balance, Energiemanagement, Ressourcenaktivierung und Perspektivenplanung, die mein Job-Hopping von der zweijährigen Projektarbeit in die einjährige Karenzvertretung in die anschließende dreimonatige Miniprojektstelle in den darauf folgenden zweimonatigen Werkvertrag mit sich ziehen, bleibt mir, um ehrlich zu sein, dazu gar keine Zeit.
1) Stefan Haslinger: „Wo brennt’s?“, in Kulturrisse 0208
2) Anke Haarmann: „Visionen und Utopien mit Haagener BürgerInnen“, 2001 Online Artikel
3) Siehe Presseerklärung von maiz im News Bereich
Vina Yun ist freie Autorin und Teil des Redaktionskollektivs der Zeitung MALMOE malmoe.
Kontakt Vina Yun