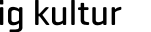Rechtsauskunft: Barbetrieb und Verein – wann greift die Gewerbeordnung?
Auch wenn Vereine Speisen und Getränke nur „zum Selbstkostenpreis“ abgeben, ist Vorsicht geboten: Die Gewerbeordnung macht vor Vereinen nicht halt – unabhängig davon, ob sie gemeinnützig sind oder nicht. Sobald ein Verein wie ein Gastgewerbe wirkt, kann die Gewerbeordnung greifen. Und selbst die günstigen Getränke für Mitglieder können als wirtschaftlicher Vorteil gewertet werden. Vereinsrechtsexperte RA Dr. Thomas Höhne zur Gewerbeordnung als Zwickmühle für Vereine mit Barbetrieb.

– Dr. Thomas Höhne ist Spezialist für Vereins- und Verbandsrecht sowie Informations- und Medienrecht. Er ist Partner von Höhne, In der Maur & Partner Rechtsanwälte. www.h-i-p.at, www.vereinsrecht.at; Nähere Details zum Vereinsrecht findet ihr in der neuen 7. Auflage des Buches "Das Recht der Vereine" von Thomas Höhne, Gerhard Jöchl und Andreas Lummerstorfer, welche Anfang 2026 erscheint.
SAVE-THE-DATE: Am 25. November, 14 Uhr, gibt es ein Webinar zum Thema "Gewerbeordnung und Kulturverein", bei welchem RA Dr. Thomas Höhne die Grundlagen erläutert und anhand eurer Praxisbeispiele und -fragen diskutiert. Details in Kürze auf igkultur.at
Die Gewerbeordnung (GewO) gilt auch für Vereine, ganz egal, ob gemeinnützig oder nicht. Es kommt auch nicht nur darauf an, was in den Statuten steht – diese können noch so „nicht auf Gewinn orientiert“ sein, wenn die Praxis anders aussieht. Und das bedeutet: Sind die faktischen Voraussetzungen für einen gewerblichen Betrieb erfüllt, unterliegt man den Vorschriften der GewO. Eine unbefugte Gewerbeausübung ist nicht nur mit Verwaltungsstrafen bedroht; finanziell noch empfindlicher können den Verein Unterlassungsklagen nach dem UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb) durch Mitbewerber treffen.
Die Gewerbeordnung ist da sehr klar:
§ 1 Abs. 2:
Eine Tätigkeit wird gewerbsmäßig ausgeübt, wenn sie selbständig, regelmäßig und in der Absicht betrieben wird, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, gleichgültig für welche Zwecke dieser bestimmt ist; hiebei macht es keinen Unterschied, ob der durch die Tätigkeit beabsichtigte Ertrag oder sonstige wirtschaftliche Vorteil im Zusammenhang mit einer in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallenden Tätigkeit oder im Zusammenhang mit einer nicht diesem Bundesgesetz unterliegenden Tätigkeit erzielt werden soll.
§ 1 Abs. 6:
Bei Vereinen … liegt die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen, auch dann vor, wenn die Vereinstätigkeit das Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebes aufweist und diese Tätigkeit – sei es mittelbar oder unmittelbar – auf Erlangung vermögensrechtlicher Vorteile für die Vereinsmitglieder gerichtet ist. Übt ein Verein … eine Tätigkeit, die bei Vorliegen der Gewerbsmäßigkeit in den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fiele, öfter als einmal in der Woche aus, so wird vermutet, dass die Absicht vorliegt, einen Ertrag oder sonstigen wirtschaftlichen Vorteil zu erzielen.
Was heißt dies nun im Klartext?
Die Behörde braucht (außer eben in den Fällen der "Amtsbekanntheit" sozialer, wohltätiger Tätigkeit) gar nicht mehr zu prüfen, ob wirklich eine Ertragsabsicht vorliegt. Sie kann sich mit der einfacheren Feststellung begnügen, dass „die Vereinstätigkeit das Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebs aufweist“, wobei allerdings dazukommen muss, dass diese Tätigkeit den Vereinsmitgliedern vermögensrechtliche Vorteile (also jede Art von Vorteil, der nicht wirklich rein ideeller Natur ist) bringen muss, wobei auch lediglich mittelbare Vorteilsbeschaffung erfasst wird. Gewinnerzielung ist also gar nicht Voraussetzung! Jede Form der Ersparnis reicht schon, wenn die abgegebenen Waren für die Mitglieder günstiger als sonst am Markt sind.
Insbesondere im Gastgewerbe war und ist der Verein als „Umgehungsmodell“ beliebt, indem Speisen und Getränke zum Selbstkostenpreis angeboten werden. Hier ein kleiner Überblick über die Argumente der Vereine, mit denen sie der Gewerbeordnung entkommen wollten und wie nützlich diese Argumente waren:
- Dass Entgelt verlangt wird, beweist allein noch nicht eine Betätigung in Gewinnabsicht, insbesondere wenn dadurch nur die – damit im Zusammenhang stehenden – Unkosten ganz oder teilweise gedeckt werden sollen; ob damit auch eine kaufmännische Gebarung verbunden ist, ist bedeutungslos. Es kommt auch nicht darauf an, ob der Verein befugt ist, nach seinen Statuten Tätigkeiten in Gewinnabsicht auszuüben, sondern darauf, inwieweit eine solche Absicht tatsächlich besteht. Ebenso kommt es nicht darauf an, ob die Tätigkeit mit dem in den Vereinsstatuten festgelegten Vereinszweck übereinstimmt.
- Dass Speisen und Getränke nur an Vereinsmitglieder abgegeben werden, schließt die Gewerbsmäßigkeit nicht aus. Und ob der Zutritt zu einem Barbetrieb nur Mitgliedern oder auch vereinsfremden Personen möglich ist, ist gleichgültig. Wenn das „Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebes“ gegeben ist (also mehr als ein Kühlschrank, aus dem man sich selbst bedient, mit einem Sparschwein, in das man ein paar Euro einwirft), dann kommt es nicht darauf an, ob diese Kantine nur Mitgliedern offensteht.
- Dass die Erträgnisse einer Tätigkeit der Verminderung des Gesamtaufwands eines Vereins, den dieser aus der Verwirklichung seiner ideellen Zwecke hat, dienen sollen, heißt noch nicht, dass der Verein (bloß deswegen) mit dieser Tätigkeit nicht der Gewerbeordnung unterläge. Für die Annahme der Gewerbsmäßigkeit genügt nicht, dass Einnahmen erzielt werden, die für Veranstaltungszwecke verwendet werden. Die Einnahmen müssen auch nicht für jene Veranstaltung verwendet werden, aus der sie entstehen; schließlich müssen Aufwendungen auch für künftig nutzbare Investitionen, die allenfalls das Vereinsvermögen vermehren, getätigt werden. Es kommt auch nicht darauf an, inwieweit der Verein nach dem Vereinsgesetz und nach seinen Statuten befugt ist, Tätigkeiten in Ertragsabsicht auszuüben, sondern darauf, in wie weit eine solche Absicht tatsächlich besteht. Wenn bei der Bewirtung der Vereinsmitglieder Einnahmen erzielt werden, die nicht nur kostendeckend sind, sondern darüber hinaus einen Kostenbeitrag für sonstige Tätigkeiten des Vereins (z.B. vollständige Abdeckung des Pachtzinses und der anfallenden Betriebskosten des Vereinslokals) darstellen, liegt die Gewinnerzielungsabsicht nahe. Zur Klarstellung: Es kommt also nicht bloß darauf an, dass unterm Strich kein Gewinn erzielt wird (es ist also nicht die Gesamtgebarung des Vereins zu berücksichtigen), sondern es kommt auf die mit dem jeweils in Rede stehenden Aspekt der Vereinstätigkeit verbundene diesbezügliche Absicht an. Getränke verkaufen, um die Miete zu bezahlen, ist also nicht möglich (jedenfalls nicht außerhalb der Gewerbeordnung).
Beispiele aus der Praxis:
Ein Klub ließ seine Mitglieder gastgewerbliche Leistungen zum Selbstkostenpreis konsumieren. Dies wurde als vermögensrechtlicher Vorteil für die Mitglieder gewertet. Da daneben auch das Erscheinungsbild eines Gewerbes gegeben war (was bei Ausschank von Getränken und der Abgabe von Speisen wohl immer der Fall sein wird), wurde die Gewerbsmäßigkeit bejaht. Typisch für diesen Fall – und auf ähnliche Fälle übertragbar – war, dass die Mitglieder Leistungen erhielten, die auch am freien Markt durch befugte Gewerbetreibende erbracht werden. (Und jene sind es auch nicht selten, die mit Anzeigen bei der Gewerbebehörde oder mit UWG-Klagen dieser unliebsamen Konkurrenz das Leben schwer machen.)
Als Erscheinungsbild eines einschlägigen Gewerbebetriebs wurde qualifiziert, dass der Verein sämtliche Personen mit den gewünschten Getränken bediente und abkassierte, auch eine Getränkekarte war vorhanden. Da die Getränke außerdem ausgesprochen kostengünstig abgegeben wurden, wurde darin ein vermögensrechtlicher Vorteil für die Mitglieder gesehen. Die Absicht, aus der Tätigkeit einen Gewinn zu erzielen, ist dabei gar nicht erforderlich. Aus § 1 Abs 6 GewO ergibt sich nicht, dass das Vorliegen sämtlicher Genehmigungsvoraussetzungen eines „einschlägigen“ Gewerbebetriebs (in dem gegenständlichen Fall eines Gastgewerbebetriebs) Voraussetzung für die Anwendung der GewO wäre; gefordert wird lediglich das Vorhandensein des „Erscheinungsbildes“ eines derartigen Gewerbebetriebs.
Ein Verein, der Speisen und Getränke ausgab, forderte Preise in ähnlicher Höhe wie in vergleichbaren Gastgewerbebetrieben und erzielte einen monatlichen Überschuss von ATS 15.000. Dies reichte, um auf die Ertragsabsicht zu schließen. Für die Annahme der Gewinnerzielungsabsicht reicht auch, wenn die aus der Ausgabe von Getränken und Speisen erzielten Einnahmen dazu verwendet werden, um den Vereinsbetrieb aufrechtzuerhalten (Miete für das Vereinslokal, Betriebskosten, Durchführung von Veranstaltungen, Beschäftigung eines Betreuers für die Mitglieder etc).
Die Zwickmühle, die sich für den Verein hier auftut, ist offenbar:
Entweder er verlangt Preise wie in anderen Gastwirtschaften auch, dann wird er einen Überschuss erzielen, weswegen über die Ertragsabsicht nicht einmal mehr diskutiert werden braucht – sie ist offensichtlich; oder er verlangt nur kostendeckende Preise, dann wendet er auf diese Weise seinen Mitgliedern einen vermögenswerten Vorteil zu, und das reicht kraft der Bestimmung des § 1 Abs 6 GewO ebenso für die Annahme der Ertragsabsicht.
IG Kultur: In der Praxis bleibt damit für viele Vereine nur die Möglichkeit, im Rahmen der 72-Stundenregelung des kleinen Vereinsfests gastronomisch tätig zu werden. Nähere Infos zum kleinen Vereinsfest und Voraussetzungen, die dafür erfüllt sein müssen, findet ihr hier.