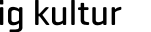Künstlerische Inklusion als gesellschaftliche Gestaltungskraft
Der Beitrag beleuchtet Künstlerische Inklusion als gesellschaftliche Gestaltungskraft. Ausgehend von der Atelierpraxis wird die These entwickelt, dass Inklusion nur durch die Mitgestaltung der Bedingungen durch alle Beteiligten entsteht. Im Zentrum steht die Praxis von Künstler:innen mit Behinderungen als methodische Akteur:innen. Ihr Wissen dazu, wie organisatorische Beweglichkeit und die Sichtbarmachung individueller Befähigung als Arbeitsprinzipien etabliert werden, kann ein Beitrag zur Gestaltung inklusiver Gesellschaftsstrukturen sein.

Vorbemerkung
Ausgangspunkt dieser Überlegungen ist die Tagung „[Dis]Ability — Fairness in Kunst und Kultur“ (KULTUM Graz, 17. Mai 2025). In den geführten Gesprächen wurde deutlich, dass Inklusion dort erfahrbar wird, wo alle Beteiligten an jenen Bedingungen mitwirken, die Austausch ermöglichen. Solche Situationen lassen sich nicht vollständig über vorgegebene Formate herstellen. Sie benötigen Formen, die auf individuelle Fähigkeiten und Anforderungen reagieren können.
Der Text richtet den Blick auf Strukturen, die im Verlauf entstehen, und auf Prozesse, in denen Arbeit ihre Bedingungen hervorbringt. Die Frage lautet, wie Arbeit verstanden werden kann, wenn sie nicht auf Vorgaben ausgerichtet ist. Damit rückt eine Auffassung von Tätigkeit in den Fokus, die sich aus situativen Kräften zusammensetzt und ihre Form im Tun entwickelt.
Die folgenden Überlegungen gründen in meiner Arbeit als künstlerischer Coach an der Malwerkstatt Graz, in der täglich künstlerische Prozesse gemeinsam entwickelt werden. In diesem geteilten Arbeiten werden Fähigkeiten ausgelotet, erprobt und zur Geltung gebracht. Zugleich wird sichtbar, dass diese Prozesse an Voraussetzungen gebunden sind: an Räume, Zeit, Assistenzleistungen und materielle Ressourcen. Beweglichkeit entsteht im Gefüge von Macht- und Ressourcenverhältnissen. Daraus ergibt sich ein Verständnis von Inklusion, das ästhetische, soziale und strukturelle Bedingungen miteinander verschränkt.
Diese Beobachtungen verbinden sich mit der allgemeineren Frage nach dem Arbeitsbegriff in der Gesellschaft. In vielen Feldern strukturieren Vorgaben Abläufe, sichern Vergleichbarkeit sowie Kontrolle und binden Bedeutung an erwartete Resultate. Formen, die sich im Tun herausbilden, erhalten darin wenig Sichtbarkeit. Der Text untersucht, wie künstlerische Praxis alternative Verfahren eröffnet und wie daraus Perspektiven für inklusive Arbeitsformen entstehen.
Antizipierende Arbeitslogiken
Gesellschaftliche Arbeit wird in vielen Bereichen über Ergebnislogiken organisiert. Fristen und Evaluationen richten den Blick auf Tätigkeiten, die erwarteten Formen entsprechen. Arbeitsprozesse, die sich im Verlauf entwickeln, geraten leicht aus dem Blick.
Diese Logiken beruhen auf ökonomischen und administrativen Bedingungen, die den Spielraum für Teilhabe nur begrenzt veränderbar halten. Prozessoffenheit erscheint daher weniger als Alternative denn als Bewegung innerhalb gegebener Rahmen. Künstlerische Verfahren markieren darin kein Gegenmodell, sondern ein anderes Verhältnis zur Form, das sich innerhalb dieser Strukturen behauptet.
Aus meiner Arbeit weiß ich, wie unterschiedlich Institutionen mit Ergebnislogiken umgehen: Manche ermöglichen flexible Räume, andere bleiben eng an quantifizierbare Wirksamkeit gebunden. Diese Differenzierung zeigt, dass Prozessoffenheit innerhalb jener Spannung operiert, in der ästhetische, soziale und administrative Anforderungen miteinander verschränkt sind.
Auch Inklusion bewegt sich in diesem Umfeld. Der Nationale Aktionsplan Behinderung 2022–2030 formuliert strukturelle Ziele, die jedoch an Bedingungen gebunden sind, die Planbarkeit priorisieren. Auch im kulturellen Feld tritt diese Spannung hervor, wenn Institutionen ihre Wirksamkeit über erwartete Ergebnisse erfassen müssen. Darin liegt eine zentrale Herausforderung inklusiver Kulturarbeit.
Die Fixierung auf normierte und quantifizierbare Ergebnisse ist im Kern ableistisch, da sie standardisierte Arbeitsgeschwindigkeiten und Kapazitäten voraussetzt. Sie definiert Teilhabe nicht über Befähigung im Tun, sondern über Anpassung an eine normierte Wirksamkeitsform. Damit wird jene Struktur sichtbar, in der Abweichung von der Norm als Mangel gerahmt wird (Shakespeare; Goodley).
Fähigkeitsbasierte Arbeitsformen und ihr Erkenntnispotenzial
Künstlerische Praxis eröffnet ein Arbeiten, das seine Struktur im Tun ausbildet. Entscheidungen orientieren sich an Situationen, Form entsteht im Verlauf. Fähigkeiten treten als Kräfte hervor, die im Handeln Gestalt gewinnen und Unerwartetes erzeugen, nicht als Merkmale, die an definierte Ergebnisse angepasst werden müssen.
Im Sinne einer performativen Auffassung von Handlung (Butler; Hantelmann) wird Tätigkeit als Prozess verständlich, der seine Bedingungen im Vollzug mit hervorbringt. Wo Arbeit nicht an antizipierte Ergebnisse gebunden ist, entstehen Erwartungen erst im Tun. Damit verbindet sich eine systemtheoretische Perspektive (Luhmann), die Strukturen als Gefüge stabilisierter Erwartungen fasst, die sich im Verlauf kommunikativer Ereignisse reproduzieren.
Fähigkeiten werden sichtbar, wenn Verfahren Beweglichkeit zulassen. Sie zeigen sich in Momenten, in denen Vorgaben an Relevanz verlieren und situative Entscheidungen Bedeutung gewinnen. In Ateliers wird sichtbar, wie solche Entscheidungen Verfahren prägen: Strukturen des Agierens entstehen im Moment und bleiben dennoch konturiert.
Daraus ergibt sich eine methodische Perspektive auf Arbeitsformen, die Veränderbarkeit zulassen müssen, damit Befähigungen wirksam werden können. Zugleich zeigt sich in der Praxis, dass ihre Sichtbarkeit an Bedingungen gebunden bleibt, etwa materielle Zugänge, soziale Unterstützung, technische Mittel und Räume, in denen Abweichung nicht vorschnell als Defizit gilt.
Beweglichkeit entsteht, wo im Aushandlungsprozess mit normativen Erwartungen Bedingungen verändert werden und sich die heterogene Entfaltung von Befähigung als Arbeitsprinzip etabliert. Fähigkeiten treten dabei immer im Verhältnis zu jenen Faktoren hervor, die ihre Entfaltung stützen oder begrenzen. Diese Perspektive korrespondiert mit Überlegungen des Capability Approach (Nussbaum; Sen), in dem Befähigungen als wirksame Elemente gesellschaftlicher Teilhabe gefasst werden.
Künstler:innen mit Behinderungen als methodische Akteur:innen
Die Prinzipien künstlerischer Praxis sind nicht an eine bestimmte Gruppe gebunden. Sie erwachsen aus der Eigenlogik ästhetischer Verfahren. In der Praxis von Künstler:innen mit Behinderungen werden sie jedoch präzise sichtbar, weil ihre Arbeitsweisen zeigen, welche räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Bedingungen Beweglichkeit unterstützen. Dieses Wissen entsteht aus konkreten Arbeitszusammenhängen und bildet ein Spektrum heterogener Positionen.
Meine eigene Arbeit besteht darin, in geteilter künstlerischer Praxis Arbeitsformen entstehen zu lassen. Das methodische Wissen dafür entsteht in geteilten Entscheidungen, Versuchen, Gesprächen, Scheitern und ästhetischen Setzungen. Dadurch verändert sich auch mein Verständnis dessen, wann und wie künstlerische Praxis Beweglichkeit zulässt und erzeugt.
Agency (selbstbestimmtes Handeln) zeigt sich dort, wo dieses situative Wissen von Künstler:innen mit Behinderungen in Prozesse einfließt, in denen Bedingungen von Inklusion verhandelt werden – als Möglichkeit, Perspektiven einzubringen, die aus der Erfahrung der Verschränkung von Tätigkeit und Bedingung entstehen.
Ateliers wie die Malwerkstatt Graz verdeutlichen solche Prozesse anschaulich: Arbeitsumgebungen entstehen dort im Rückbezug auf individuelle Befähigungen. Künstlerische Entscheidungen bestimmen über Assistenzformen, räumliche und andere Anpassungen. Diese Orte zeigen, dass Beweglichkeit nur dort möglich ist, wo strukturelle Bedingungen im Arbeitsprozess mitentwickelt werden.
Daraus ergibt sich die Perspektive auf zukünftige Modelle: Inklusive Atelierhäuser könnten als offene, ko-kreative Produktionsräume für alle Künstler:innen entstehen. Solche Orte gemeinsamer Praxis ohne normative Vorgaben transformieren die Logik getrennter Räume in eine Struktur geteilter Gestaltung und weisen auf neue strukturelle Möglichkeiten über den Kunstkontext hinaus.
Inklusive Gestaltungskraft
Die in Ateliers beobachtbaren Verfahren zeigen, dass Bedingungen im Verlauf entstehen können. Daraus ergibt sich für andere Bereiche eine Perspektive auf Organisation, deren Form nicht ausschließlich aus stabilen Vorgaben hervorgeht, sondern aus der Mitwirkung der Beteiligten. Teilhabe bedeutet in diesem Verständnis Beteiligung an der Hervorbringung der Bedingungen gesellschaftlicher Prozesse.
Diese Beobachtungen beschreiben keine Übertragbarkeit künstlerischer Prozesse als Modell, sondern die Praxis organisatorischer Beweglichkeit. Sie verbinden sich mit der Vision gemeinsamer Atelierhäuser, in denen Prozesse Raum für Gestaltung öffnen, wenn Befähigungen ernst genommen und Bedingungen aktiv veränderbar gedacht werden.
Zugleich zeigt die Praxis, dass strukturelle Veränderung kulturpolitische Entscheidungen, langfristige Ressourcen und institutionelle Öffnungen voraussetzt. Ästhetische Verfahren können Veränderungen aber epistemisch und gestalterisch begleiten.
Der von Hantelmann beschriebene performative Charakter künstlerischer Praxis bildet dafür einen interpretativen Rahmen, der sichtbar macht, wie künstlerisches Handeln an den Bedingungen seiner eigenen Wirksamkeit mitproduktiv beteiligt ist, ohne die strukturelle Logik gesellschaftlicher Felder zu negieren. Art. 30(2) der UN-Behindertenrechtskonvention verweist in diesem Sinn auf die strukturelle Relevanz, dass Künstler:innen mit Behinderungen „ihr kreatives, künstlerisches und intellektuelles Potenzial … zur Bereicherung der Gesellschaft“ einbringen können.
Inklusion erscheint so als Gestaltungskraft. Künstlerische Verfahren zeigen, wie Strukturen aus Arbeit hervorgehen und sich im Verlauf entwickeln. Dadurch entsteht ein inklusiver Beitrag zur Gesellschaft, der Arbeitsformen, Organisationsweisen und strukturelle Prozesse durch Teilhabe mitzugestalten weiß.
Dipl. (bild. Kunst) René Corvaia-Koch, MA ist Bildender Künstler, Künstlerischer Coach an der Malwerkstatt Graz von Jugend am Werk Steiermark und Research Fellow der Uni Graz im Bereich Intermediale Geschlechtskonstruktionen.
Literatur:
Politische und rechtliche Rahmenwerke
BMSGPK. Nationaler Aktionsplan Behinderung 2022–2030 (NAP Behinderung). Wien: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 2022.
https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:a593ed14-dba1-466b-b8b5-d04…
BMSGPK. Evaluierung des NAP 2012–2020. Wien: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, 2023.
https://www.sozialministerium.gv.at/dam/jcr:ec106d2c-7346-4360-8756-975…
BMSGPK (Hg.). UN-Behindertenrechtskonvention – Deutsche Übersetzung der Konvention und des Fakultativprotokolls. Wien: BMSGPK, 2016.
>https://broschuerenservice.sozialministerium.gv.at/Home/Download?public…
Kunst, Kunsttheorie und Performativität
Hantelmann, Dorothea von. How to Do Things with Art: The Meaning of Art’s Performativity. Berlin: Diaphanes, 2010.
Butler, Judith. Bodies That Matter: On the Discursive Limits of “Sex”. New York: Routledge, 1993.
Egermann, Eva (Hg.). Crip Magazine #1–5. Wien: Eigenverlag Eva Egermann, 2012–2021; #5 Istanbul: İstanbul Foundation for Culture and Arts (İKSV) / Phileas – A Fund for Contemporary Art, 2022. http://cripmagazine.evaegermann.com — wichtige Plattform für crip-ästhetische und künstlerische Positionen.
Disability Studies & Ableism-Forschung
Shakespeare, Tom. Disability Rights and Wrongs. London: Routledge, 2006.
Goodley, Dan. Dis/ability Studies: Theorising Disablism and Ableism. London: Routledge, 2014.
Jung, Corinna. „Kunst von Menschen mit einer anderen Sichtweise – Kunst als Weg zur Inklusion.“ In Inklusion und Partizipation in Kunst und Kultur, hrsg. von Anja Unger und Andreas Walther, 45–54. Marburg: Lebenshilfe Verlag, 2023. — Emanzipatorischer Zugang zu inklusiver künstlerischer Praxis
Gerechtigkeitstheorien & Capability Approach
Nussbaum, Martha. Creating Capabilities: The Human Development Approach. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011.
Sen, Amartya. The Idea of Justice. London: Allen Lane, 2009.
Systemtheorie
Luhmann, Niklas. Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984.
Aktuelle kulturpolitische Debatten
Wahl, Hannah. Radikale Inklusion. Ein Plädoyer für Gerechtigkeit. Graz: Leykam Verlag, 2023. — Positioniert Inklusion als gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe
Rodriguez y Romero, Joachim. „Von Ausgrenzung zu Akzeptanz: Wie die Kunst zur Inklusion beitragen kann.“ Kunstplaza, 27. Oktober 2025. https://www.kunstplaza.de/kunstszene-2/ausgrenzung-akzeptanz-inklusion/ — Beschreibt Kunst als vermittelnde Praxis
Pilling-Kempel, Caroline-Sophie, und Thomas Wilke. „Inklusion aus einer Perspektive der Kulturellen Bildung. Ein Problemaufriss gegenwärtiger Spannungsverhältnisse.“ kubi-online, 2025. https://www.kubi-online.de/artikel/inklusion-aus-einer-perspektive-kult… — Definiert Inklusion als diskursiven, offenen Prozess