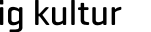FAQs: Abrechnung von Kulturförderungen des Bundes
Viele Kulturvereine stehen regelmäßig vor der gleichen Herausforderung: Die Abrechnung einer Förderung des Bundes. Welche Unterlagen sind einzureichen, wie sollen diese aussehen, was gilt bei Änderungen – und was tun, wenn am Ende ein kleines Plus bleibt? Hier die wichtigsten Hinweise aus der Praxis, basierend auf einem Arbeitsgespräch mit der Förderkontrolle Kunst und Kultur des Bundes.
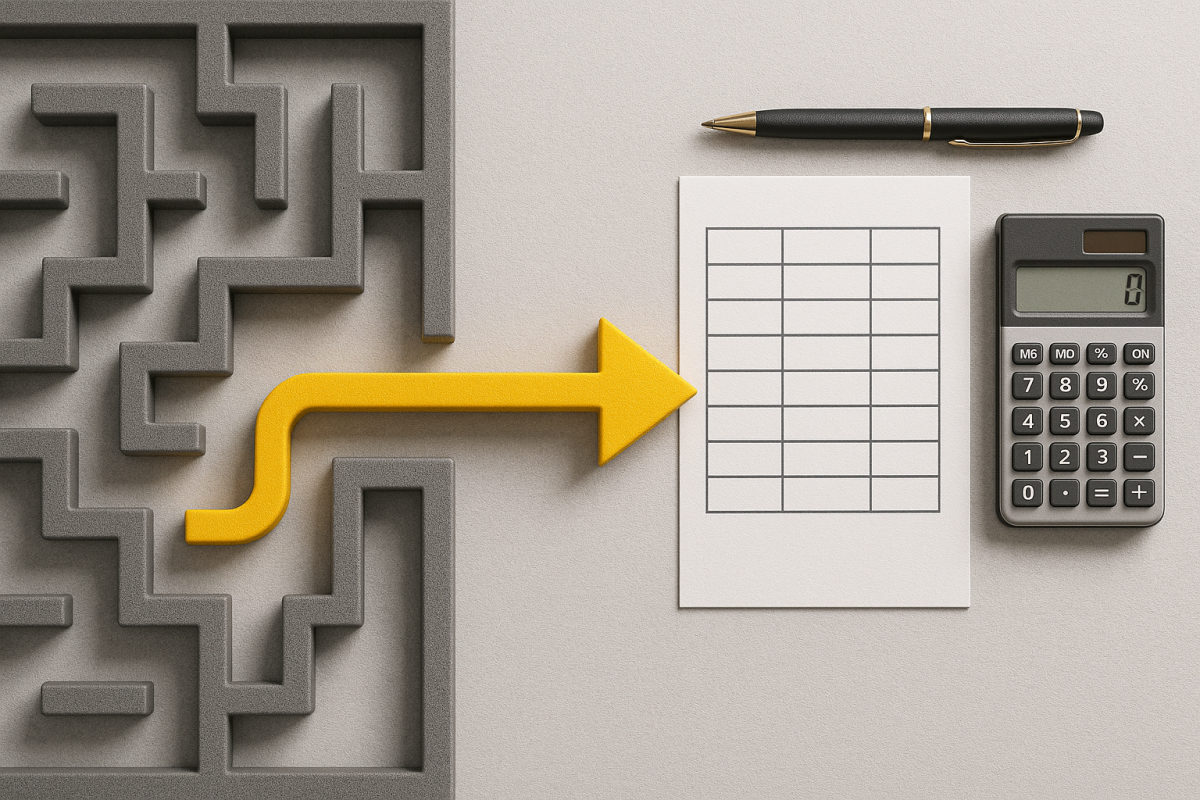
Förderung = Vertrag
Was oft in Vergessenheit gerät: Jede Förderung ist ein Vertrag. Dieser endet nicht automatisch mit Abschluss des geförderten Projekts, sondern erst dann, wenn die sogenannte Entlastung durch die Förderkontrolle erfolgt ist. Die Entlastung ist die schriftliche Bestätigung des Bundes, dass die Fördermittel widmungsgemäß verwendet wurden. Solange diese Entlastung nicht vorliegt, besteht das Vertragsverhältnis weiter. Wenn im Zuge der Prüfung der Förderabrechnung Beanstandungen auftauchen – also Unklarheiten oder Nachforderungen, kann dies im schlimmsten Fall zu Rückforderung der Förderung bzw. eines Teilbetrags der Förderung (inkl. Zinsen) führen.
Es handelt sich also um ein rechtlich bindendes Verhältnis – wichtig, sich dessen bewusst zu sein.
Häufige Probleme aus der Förderpraxis
In der Praxis zeigen sich aus Sicht der Förderkontrolle immer wieder ähnliche Schwierigkeiten:
- Unvollständige Unterlagen
- Nichtbeachtung der formalen Vorgaben
- Fehler bei der Zeichnungsberechtigung
Daher einige grundlegende Hinweise:
1. Förderzusage und Nachweiserfordernisse genau lesen
Lest die Förderzusage und die darin enthaltenen Nachweiserfordernisse sorgfältig durch. Wenn keine Originalbelege gefordert sind, übermittelt auch keine. Wenn physische Belegexemplare (z.B. Kataloge, Buchausgaben) verlangt werden, achtet genau darauf, an wen diese zu senden sind – in der Regel an die Förderkontrolle, nicht an die Fachabteilung, die die Förderung bewilligt hat.
2. Zeichnungsberechtigung prüfen
Wer für euren Verein zeichnungsberechtigt ist („zur Vertretung nach außen befugt“), ergibt sich aus euren Statuten. Diese Person bzw. Personen – zumeist bestimmte Vorstandsmitglieder – müssen sowohl die Einreichung als auch die Abrechnung unterschreiben.
Ändert sich etwas (z. B. durch Wahl eines neuen Vorstands), muss dies der Förderstelle gemeldet werden. Insbesondere wenn sich die zeichnungsberechtigte/n Person/en zwischen Antragstellung und Abrechnung ändern, sollte dies im Online-Abrechnungsformular im Feld für „Allgemeine Anmerkungen“ vermerkt werden und ein aktueller Vereinsregisterauszug (ZVR-Auszug) beigefügt werden.
3. Änderungen im Projektverlauf bzw. Jahrestätigkeit bekanntgeben
Alle wesentlichen Änderungen gegenüber dem Förderantrag müssen gemeldet werden. In der Praxis relevant sind insbesondere Verzögerungen, die die Projektlaufzeit verlängern, Reduktionen im Programm oder größere inhaltliche oder budgetäre Änderungen. Diese Änderungen sind der Fachabteilung bereits im Projektverlauf bekannt zu geben – im Optimalfall unter Angabe der Geschäftszahl eurer Förderung (dem Zusageschreiben zu entnehmen), einer aussagekräftigen Betreffzeile sowie einem angefügten unterzeichneten PDF. Denn rein formal, handelt es sich um eine Vertragsänderung, der die Gegenseite zustimmen muss.
Ebenso sind interne Änderungen – wie neue zeichnungsberechtigten Personen im Verein (siehe oben) oder neue Kontaktdaten bekannt zu geben.
Wichtig: Diese Änderungen sollten nicht im Tätigkeitsbericht versteckt sein, sondern sobald sie absehbar sind, der Fachabteilung gemeldet werden bzw. bei der Abrechnung im Online-Formular unter „Allgemeinen Anmerkungen“ angeführt sein.
4. Erforderliche Abrechnungsunterlagen – was und wie
Gefordert ist immer genau das, was im Fördervertrag bzw. im Zusageschreiben angeführt ist. Diese Nachweiserfordernisse sind Vertragsbestandteil und können sich je nach Förderart unterscheiden.
Üblicherweise umfasst der Nachweis:
- das bei Fördereinreichung übermittelte Kalkulationsformular, ergänzt um die tatsächlichen Einnahmen-/Ausgaben
- eine Belegaufstellung (maschinenlesbar, d. h. keine Scans oder Fotos),
- eine Einnahmen-Ausgaben-Rechnung bzw.
- einen Jahresabschluss bei Jahrestätigkeiten (Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und Vermögensübersicht bei kleinen Vereinen bzw. Bilanz und Gewinn-und-Verlustrechnung bei großen Vereinen)
- und inhaltliche Nachweise (z. B. Tätigkeitsbericht, Veranstaltungsdokumentation, Belegexemplare).
Originalbelege sollen nicht mitgeschickt werden, außer sie werden ausdrücklich angefordert.
Praxishinweise:
- Abgesehen vom Kalkulationsformular besteht keine Pflicht zur Verwendung der bereitgestellten Formularvorlagen. Dies ist lediglich als Service bzw. als Orientierungshilfe zu sehen. Wer über eigene, nachvollziehbare Aufstellungen verfügt – z.B. in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung oder im Jahresabschluss, kann diese verwenden, solange alle geforderten Angaben enthalten sind.
- Die Dokumente sollen „maschinenlesbar“ sein. Das heißt jedoch laut Förderkontrolle nicht, dass offene Exceltabellen übermittelt werden müssen, sondern Originaldateien oder daraus erzeugte PDFs. Scans oder Fotos sind nicht erwünscht! Ebenso können aus technischen Gründen keine Numbers- bzw. Pages-Dateien übermittelt werden.
- Die Belegaufstellung sowie die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung müssen in Zukunft nicht mehr unterzeichnet werden. Die Unterzeichnung via Bestätigungsblatt oder ID-Austria im Rahmen der Online-Abrechnungsformulars ist ausreichend.
Rechtlicher Hinweis: Selbstverständlich gelten die Bedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses, d.h. wenn sich die Förderrichtlinien zwischenzeitlich geändert haben, gelten dennoch jene Förderrichtlinien, die zum Zeitpunkt eurer Einreichung aktuell waren. Speichert euch bei jeder Fördereinreichung auch stets die relevante geltende Förderrichtlinie ab, da ältere Richtlinien (noch) nicht über die Website des BMWKMS abrufbar sind.
5. Wie vorgehen, wenn bis zur Abrechnungsfrist nicht alle Unterlagen fertig sind
Die Abrechnung darf nur vollständig eingereicht werden – Teilübermittlungen werden nicht angenommen bzw. von der Förderkontrolle bearbeitet! Wenn bis zur Frist noch Unterlagen fehlen, ist es daher notwendig, rechtzeitig eine Fristverlängerung zu beantragen. Der Antrag kann direkt über das Online-Abrechnungsportal gestellt werden und sollte immer eine kurze Begründung und ein neues, realistisches Zieldatum enthalten. Eine formlose E-Mail reicht nur ausnahmsweise.
Wichtig: Ohne genehmigte Fristverlängerung gilt eine verspätete oder unvollständige Einreichung formal als Vertragsverletzung. Die Förderkontrolle zeigt sich hier kulant, erwartet aber, dass der Antrag auf Fristverlängerung vor Ablauf der ursprünglichen Frist eingebracht wird.
6. Was, wenn am Ende ein Plus bleibt?
Hier ist zu unterscheiden:
- Projektförderungen oder zweckgebundene Förderausschreibungen (z.B. Investitionsförderungen):
Diese müssen Euro-genau abgerechnet werden. Das heißt: ein verbleibender Überschuss – weil z.B. zufällig mehr Eigenmittel erwirtschaftet wurden oder sparsamer ausgegeben wurde – führen regelmäßig zu Rückforderungen (anteilig zum Bundesförderungsanteil).
Bei Förderausschreibungen, die einen gewissen Prozentsatz fördern (z.B. Investitionen) ist zu beachten, dass der Prozentsatz strikt eingehalten wird. Fallen die Ausgaben geringer aus, als veranschlagt, führt dies somit ebenfalls zu Rückforderungen da der Anteil der Bundesförderung prozentuell gedeckelt ist. - Jahresförderungen:
Hier können Rückstellungen bis zu einem gewissen Grad zulässig sein, die zu einem scheinbaren „Überschuss“ im Jahresabschluss führen – jedoch unter der Voraussetzung, dass deren Zweckbindung klar nachvollziehbar ist, beispielsweise Rückstellungen für per Vorstandsbeschluss geplante Investitionstätigkeiten, Rückstellungen um laufende Verträge oder Kündigungsfristen von Mitarbeitenden einhalten zu können oder für zweckgewidmete Förderungen für Projekte in Folgejahren. Entscheidend ist, dass dies mittels Rechnungsabgrenzung im Jahresabschluss nachvollziehbar dargestellt wird und die Bundesförderung in voller Höhe belegmäßig abgerechnet wird.
7. Warten auf Rückmeldung der Förderkontrolle
Nach Einreichung der Abrechnung gilt: Die Entlastung erfolgt erst, wenn die Förderkontrolle die Abrechnung geprüft und freigegeben hat („Bestätigung der widmungsgemäßen Verwendung“). Wenn ihr über längere Zeit keine Rückmeldung erhaltet, ist das noch kein Grund zur Sorge. Derzeit kommt es aufgrund begrenzter Ressourcen und Nacharbeiten aus der Corona-Zeit zu Verzögerungen bei der Bearbeitung.
8. Beanstandungen durch die Förderkontrolle
Wenn Beanstandungen oder Nachforderungen von der Förderkontrolle kommen, die euch nicht nachvollziehbar erscheinen, fragt bei der Förderkontrolle nach (Kontaktdaten siehe unten). Entscheidend ist, darauf zu reagieren, argumentativ Stellung zu nehmen und Sachverhalte nachvollziehbar zu erläutern, die in den Unterlagen vielleicht nicht klar erkennbar waren. Gerne unterstützen wir euch dabei!
9. Probleme mit dem Online-Abrechnungsformular
Das neu Online-Abrechnungsformular ist erst seit Sommer 2025 im Einsatz. Technische Schwierigkeiten sind daher nicht ausgeschlossen – z. B. ist die Funktion für mehrere zeichnungsberechtigte Personen noch nicht implementiert. Wenn euch Fehler oder Schwierigkeiten auffallen, meldet sie bitte sowohl uns als auch der Förderkontrolle, damit das System verbessert werden kann.
Abrechnungen gehören zum Alltag freier Kulturarbeit. Sie sind selten das, wofür Zeit und Energie eigentlich gedacht waren – und doch binden sie davon oft mehr, als ursprünglich geplant. Umso wichtiger ist es, die Abläufe zu verstehen, Erfahrungen zu teilen und Wissen weiterzugeben. Denn wer die Verfahren versteht, kann auch ihre Grenzen benennen – und an besseren Strukturen mitarbeiten.
Weiterführende Informationen
Abrechnungsportal Förderkontrolle: formularservice.gv.at
Informationen zur Förderabrechnung und Mustervorlagen: bmwkms.gv.at/foerderkontrolle-foerderabrechnung
Kontakt Förderkontrolle: Abt. UG 32 – Förderkontrolle Kunst und Kultur, Concordiaplatz 2, 1010 Wien, foerderkontrolle32@bmwkms.gv.at