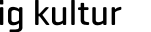Fairness codieren, Kultur verändern: Ein Überblick über den Fairness Codex
Wie können Akteur:innen im Kulturbereich ihr Arbeitsumfeld fairer, diversitätssensibler, nachhaltiger und vielfältiger gestalten? Aus dieser Frage entstand der österreichische Fairness Codex – ein Tool, das Orientierung bei der gemeinsamen Gestaltung inklusiver sowie fairer Arbeitsbedingungen geben kann. Nachfolgend findet sich ein Überblick über den Entstehungskontext sowie die zentralen Inhalte.

Der Fairness Codex versteht sich als Antwort auf die Notwendigkeit, zentrale Werte wie Respekt, Wertschätzung, Nachhaltigkeit, Vielfalt und Transparenz im Kulturbetrieb klar zu definieren und praktikable Wege für deren Umsetzung zu bieten. Auf Anregung der IG Freie Theaterarbeit wurde der Codex vom Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport gemeinsam mit der Fokusgruppe Fairness Codex, einem Zusammenschluss von Bund, Ländern und Interessensgemeinschaften entwickelt.
Das Ziel ist, sowohl das Bewusstsein für diese Prinzipien zu stärken als auch konkrete Maßnahmen und strukturelle Veränderungen nachhaltig zu verankern sowie gemeinsame Leitlinien für eine verbesserte Zusammenarbeit aller Kunst- und Kulturschaffenden in Österreich zu formulieren. Aus dem Fairness Codex entstand 2023 der Fairness Katalog, der sich als praxisorientiertes Toolkit versteht.
Ausgangspunkt sämtlicher Überlegungen ist der Gedanke, dass alle im Kunst- und Kulturbereich tätigen Menschen, ob auf institutioneller oder individueller Ebene, Verantwortung für ein faires, inklusives und nachhaltiges Arbeitsumfeld übernehmen. Denn Fairness kann nicht alleine durch theoretische Vorgaben entstehen, sondern erst durch Bewusstsein, Selbstreflexion und gemeinsames Handeln. Bevor Maßnahmen zur Schaffung eines faireren Arbeitsumfelds aber überhaupt wirksam werden können, muss vorab ein Verständnis etabliert werden, was Fairness für jede:n individuell bedeuten. Schließlich bringt jeder Mensch unterschiedliche Erfahrungen, Erwartungen und Machtpositionen mit, die sein persönliches Verständnis von Fairness prägen. Deswegen ist auch jede im Kulturbereich tätige Person aufgefordert, ihre Umgebung gerechter zu gestalten.
Der erste Schritt liegt im Erkennen der eigenen Handlungsspielräume: Wo kann jede:r Einzelne ansetzen, um Kommunikation, Zusammenarbeit und Strukturen fairer zu gestalten? Fairness ist kein Gesetz, welches befohlen werden kann, sondern ein kontinuierlicher Entwicklungsprozess, der Aufmerksamkeit, Reflexion und Geduld erfordert. Veränderung geschieht dabei nicht über Nacht, sondern entsteht graduell und sukzessiv. Um faire Strukturen zu fördern, ist es wichtig, mögliche Problemfelder zu erkennen und benennen. Es wird empfohlen, bestehende Machtverhältnisse kritisch zu hinterfragen und zu analysieren, wann Arbeitsweisen als ungerecht empfunden werden. Aus diesem Bewusstsein können gezielte Maßnahmen entwickelt werden, um Ungleichgewichte auszugleichen und faire Arbeitsbedingungen zu ermöglichen. Dabei geht es nicht um Schuldzuweisung, sondern um ein gemeinsames Lernen und Wachsen.
Damit das gelingen kann, werden im Fairness Codex vier Grundwerte vorgestellt, die als Säulen einer gerechten und zukunftsfähigen Kulturlandschaft verstanden werden:
- Respekt & Wertschätzung: Zusammenarbeit auf Augenhöhe und ein inklusives, sicheres Arbeitsumfeld sind unerlässlich. Verschiedene Perspektiven und Sichtweisen sollen offen zum Ausdruck gebracht werden und konstruktiv miteinander diskutiert werden können, wobei ein respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander stets gewährleistet bleibt. Dabei sind faire und transparente Vergütungen, Gehälter sowie Gagen ebenso wichtig, wie familienfreundliche Arbeitsbedingungen und soziale Absicherung. Toxische Arbeitskulturen, die im künstlerischen Bereich lange als „notwendig“ oder „genial“ verklärt wurden, sind aktiv zu hinterfragen. Denn Respekt bedeutet auch, dass faire Bezahlung und Anerkennung der künstlerischen Arbeit als Grundpfeiler verstanden werden – nicht als Luxus.
- Nachhaltigkeit: Langfristiges und umsichtiges Handeln ist notwendig, um Ressourcen – ökologisch, wirtschaftlich und sozial - verantwortungsvoll zu nutzen. Nachhaltige Kunstproduktion geht weit über die Fragen hinaus, ob Bühnenbilder recycelt oder Tourneen klimafreundlicher gestaltet werden: Nachhaltig bedeutet ebenso, langfristige Perspektiven für Künstler: innen zu schaffen, faire Arbeitsbedingungen zu fördern und Zeit als wertvolle Ressource sichtbar zu machen. Mögliche Ansätze dafür können die Vermeidung von Überproduktion, höhere Wiederverwertungsraten und eine verbesserte Balance zwischen Arbeit und Regeneration sein. Ziel ist es, ein Kulturverständnis zu fördern, das Qualität höher bewertet als Quantität und den Menschen wieder in den Mittelpunkt rückt.
- Vielfalt: Unterschiedliche Hintergründe, Disziplinen und Perspektiven bereichern Kunst und Kultur. Der bewusste Umgang mit Diversität, die Bekämpfung struktureller Diskriminierung und das Sichtbarmachen von marginalisierten Gruppen sind zentrale Anliegen. Vielfalt soll nicht als bloßes Lippenbekenntnis verstanden, sondern als gesellschaftliche und ästhetische Bereicherung verstanden und gelebt werden. Damit das gelingt, muss Diskriminierung aktiv entgegengentreten werden. Etwa, indem Führungsstrukturen neu gedacht werden, Sensibilisierungsarbeit honoriert wird und Elternschaft oder Behinderung nicht länger als Hindernisse für künstlerische Karrieren gewertet werden. Wahre Diversität bedeutet auch immer eine Machtverteilung und damit Veränderung.
- Transparenz: Diese bildet auch in der Kulturarbeit die Grundlage für Vertrauen und gerechte Teilhabe. Eine offene Kommunikation von Entscheidungsprozessen, Honoraren und Bewerbungsbedingungen schafft Klarheit und ermöglicht das Nachvollziehen von Programmauswahlen und Fördermittelverteilungen. Praktisch umsetzen lässt sich Transparenz beispielsweise durch die Offenlegung von Budgets, die Veröffentlichung von Kriterien sowie die Möglichkeit anonymes Feedback zu geben. Institute und Förderstellen sind dazu aufgefordert, ihre Strukturen zugänglich zu gestalten und die Verteilung ihrer Ressourcen verständlich zu kommunizieren.
Ein wesentlicher Bestandteil des auf dem Fairness Codex basierenden Fairness Katalogs ist eine Sammlung konkreter Praxisbeispiele und unterstützender Ressourcen, die zeigt, wie faire, nachhaltige und inklusive Arbeitsweisen im Kulturbereich bereits erfolgreich umgesetzt werden. Dadurch wird deutlich, dass Fairness nicht aus Leitbildern entstehen kann, sondern erst dann wirkmächtig wird, wenn bewusste Strukturen und durchdachte Maßnahmen etabliert werden.
Ein plakatives Beispiel ist das Konzept der „sanften Arbeitszeit“ der Choreografien Claire Lefèvre: In der ersten Stunde nach Öffnung des Proberaums können Künstler:innen selbst bestimmen, wie sie ihre Zeit nutzen – sei es zum Aufwärmen, zur Erledigung privater Angelegenheiten oder für eine ruhige Vorbereitung. Die Praxis stärkt Eigenverantwortung und Achtsamkeit, ohne den Arbeitsfluss zu beeinträchtigen.
Auch strukturelle Anpassungen können Fairness im Alltag spürbarer machen. In der Balettkompanie der Oper Chemnitzsind beispielsweise regelmäßige Pausen nach 90 Minuten Probezeit vertraglich festgelegt, während der Wiener Kunstverein Pufferfish das tägliche Morgentraining seiner Tänzer:innen als Arbeitszeit vergütet. Andere Ideen verbinden Gemeinschaftssinn mit Nachhaltigkeit, etwa wenn Choreograf Elio Gervasi das gemeinsame Mittagessen für sein Ensemble selbst zubereitet. Dadurch werden nicht nur Ressourcen gespart, sondern auch die soziale Bindung des Teams gestärkt. Auch Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie zeigen Wirkung: So bezahlte das Kollektiv Toxic Dreams einer Tänzerin die Kosten des Babysitters während einer Abendvorstellung und die britische Podcastreihe The Guilty Feminist verlegte ihre Aufzeichnungen auf den Vormittag, um Müttern die Teilhabe zu erleichtern.
Fairness wird jedoch nicht alleine durch individuelles Engagement erreicht: Auch Förderstellen und Institutionen tragen Verantwortung. Auf europäischer Ebene integriert das Programm Creative Europe beispielsweise Themen wie Inklusion, Gleichstellung und Umweltbewusstsein in allen Förderungen. Die Mobilitätsförderung Culture Moves Europe bietet finanzielle Zuschüsse für nachhaltige und inklusive Reiseentscheidungen, zum Beispiel in Form durch Zuschüsse für flugzeugfreie Reisen, für Künstler: innen mit Behinderungen oder für Familien mit kleinen Kindern.
Neben diesen exemplarischen Best-Practice-Beispielen stellt der Fairness Katalog auch eine Vielzahl an Hilfsmitteln, Referenzen und Leitfäden für mehr Fairness bereit. Dazu gehören internationale Verhaltenskodizes wie Julie´s Bicycle, der Fair Practice Code Netherlands oder Fair Stage Berlin, ebenso wie praxisorientierte Tools zur Kommunikation, für Konfliktlösungen und Vertragsverhandlungen. Außerdem verweist der Katalog auf zahlreiche Hilfsmittel, etwa Beispielsverträge, Kalkulationstools für Mindesthonorare, Leitfäden zur gewaltfreien Kommunikation, Checklisten für Feedbackprozesse oder Musterklauseln gegen Rassismus und Diskriminierung.
Der Fairness Katalog setzt einen neuen Standard für die Arbeitswelt in der Kunst- und Kulturszene und verdeutlicht, dass faire Bedingungen, Diversität und Nachhaltigkeit nicht nur ethische Leitbilder, sondern zentrale Voraussetzungen für zeitgemäße künstlerische Arbeit sind.
Das größte Potenzial des Katalogs liegt darin, Kunstschaffende, Institutionen und Förderstellen miteinander ins Gespräch zu bringen und Handlungsspielräume zu eröffnen, die vorher kaum denkbar waren. Indem Verantwortlichkeiten benannt, Prozesse sichtbar gemacht und selbstbewusst Forderungen nach Gerechtigkeit und Transparenz formuliert werden, gewinnt die freie Szene an Perspektive und Professionalität. Am Ende dieses Entwicklungsweges steht nicht nur ein gewinnbringender Wandel innerhalb der Kulturlandschaft, sondern – mittelbar – auch ein Nutzen für die Gesellschaft insgesamt: denn dort, wo Fairness und gegenseitige Wertschätzung gelebt werden, entstehen Innovation, Teilhabe und gesellschaftlicher Zusammenhalt.