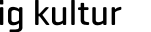Rechtsauskunft: Die Tücken von befristeten Arbeitsverhältnissen
Befristete Arbeitsverträge sind im Kulturbereich weit verbreitet – sei es aufgrund von Projekttätigkeit, saisonalen Abläufen oder zeitlich befristeten Förderverträgen. Doch wann sind solche Befristungen tatsächlich rechtlich zulässig, und wo beginnt das Risiko einer unzulässigen Kettenbefristung? MMag. Dr. Andrea Potz, Rechtsanwältin und Expertin für Arbeitsrecht, erläutert die Rechtslage und gibt Einblick in die aktuelle Rechtssprechung, mit Fokus auf Kulturvereine als Arbeitgeber.

Personalplanung ist (auch) eine Kostenfrage. Welche Stelle man ausschreibt und besetzen möchte, ist nicht nur eine Frage der unternehmerischen „Needs“, sondern auch eine Frage der Finanzierung. Gerade bei Projektgeschäften oder im Bereich mit Drittmittelfinanzierung sind sowohl der Personalbedarf als auch die finanziellen Mittel von vornherein (zeitlich) begrenzt. Es stellt sich daher die Frage, in welchem Umfang Arbeitsverträge von der Laufzeit von Projekten und/oder externer Finanzierung abhängig gemacht werden können.
Eine mögliche arbeitsrechtliche Gestaltung ist die Befristung von Arbeitsverträgen. Befristete Arbeitsverträge zeichnen sich dadurch aus, dass von vornherein ein bestimmter Endzeitpunkt des Arbeitsverhältnisses vereinbart wird, üblicherweise ein bestimmtes Datum (z.B. Befristung bis 31.12.2025). Es kann aber auch ein sonst objektiv bestimmbares Ereignis sein, etwa die Befristung bis zum Ende einer (bestimmbaren!) Spielsaison. Ist das Befristungsende dagegen unbestimmt, liegt keine wirksame Befristung vor und das Arbeitsverhältnis ist von Beginn an unbefristet. Unwirksam wäre bspw. eine Befristungsabrede, wonach das Arbeitsverhältnis bis zum Ende des Auftrags befristet sein soll, wenn das Auftragsende nicht absehbar ist.
Der Vorteil des befristeten Arbeitsvertrages liegt darin, dass der Vertrag automatisch mit Zeitablauf endet, eine gesonderte Kündigung ist nicht erforderlich. Weder Arbeitgeber*innen oder Arbeitnehmer*innen müssen daher aktiv werden, um das befristete Arbeitsverhältnis zu beenden. Der einzige Unterschied zwischen einem befristeten und einem unbefristeten Arbeitsverhältnis ist daher die Art der Beendigung.
Eine Befristung schließt die Kündigung des Arbeitsverhältnisses aus. Die gesetzlichen Bestimmungen zur Kündigung kommen bei Befristungen nicht zur Anwendung. Vertraglich kann aber eine Kündigungsmöglichkeit vereinbart werden. Dies ist aber nur bei längeren Befristungen (Richtschnur: länger als sechs Monate) zulässig. Ansonsten kann das Arbeitsverhältnis während der Laufzeit der Befristung nur einvernehmlich oder durch Entlassung (durch Arbeitgeber*innen) bzw vorzeitigen Austritt (durch Arbeitnehmer*innen) beendet werden.
Die unterschiedliche Beendigung von befristeten und unbefristeten Arbeitsverträgen macht insofern einen wesentlichen Unterschied, als bei einer Beendigung durch Zeitablauf – mangels Kündigung – kein Kündigungsschutz greift.
Um den Kündigungsschutz nicht mit befristeten Arbeitsverträgen zu umgehen, sind der Aneinanderreihung befristeter Arbeitsverhältnisse, so genannten Kettenbefristungen, Grenzen gesetzt. Grundsätzlich gilt, dass die erste Befristung eines Arbeitsvertrages zulässig ist und auch keine besondere Begründung benötigt. Sollte aber derselbe Arbeitsvertrag befristet verlängert werden, ist bereits diese erstmalige befristete Verlängerung nur zulässig, wenn dafür ein sachlicher Grund besteht. Ohne sachlichen Grund ist die Befristung (nicht der ganze Vertrag!) nichtig und der Arbeitsvertrag somit bereits unbefristet – selbst wenn beide Vertragspartner*innen einen befristeten Vertrag wollten. Die Zulässigkeit von Kettenbefristungen hängt daher vom Grund für die Befristung ab, wobei der Prüfmaßstab für die sachliche Rechtfertigung bei jeder weiteren Befristung strenger wird. In der Praxis lassen sich mehr als zwei Befristungen nur schwer rechtfertigen. Eine allgemeine gesetzliche Regelung, die die Befristungsdauer oder die Anzahl der Befristungen regelt, besteht allerdings nicht.
Im Einzelfall muss die Kettenbefristung durch besondere „soziale“ oder „wirtschaftliche“ Gründe gerechtfertigt werden. Da die Gründe gesetzlich nicht geregelt sind, greift die Praxis auf die reichhaltige, aber leider auch einzelfallabhängige Rechtsprechung zurück, aus der Fallgruppen zulässiger Befristungen abgeleitet werden können. Zulässig sind Kettenbefristungen etwa für die Dauer der Vertretung eines anderen Arbeitnehmers oder Arbeitnehmerin (zB während einer Elternkarenz), für die Beschäftigung in (echten) Saisonbetrieben oder zur Erprobung oder Ausbildung von Arbeitnehmer*innen. Die (wiederholte) Befristung muss sich dabei mit dem zugrundeliegenden Grund decken und einen klaren sachlichen Zusammenhang aufweisen: Wenn eine Ausbildung für den konkreten (!) Job daher typischerweise drei Monate dauert, kann man diesen Zeitraum übersteigende Befristungen damit nicht rechtfertigen.
Der Trend in der Rechtsprechung wird aber zusehend strenger: unbefristete Arbeitsverträge sollen die Regel sein und (Ketten-)Befristung möglichst vermieden werden. Das gilt auch für den Kulturbereich. Branchenüblichkeit wird kaum als Rechtfertigungsgrund akzeptiert (eine Ausnahme bildet Profifußball). Kulturbetriebe sind oftmals saisonal ausgerichtet, von Drittmittel abhängig und/oder arbeiten teils stark projektorientiert. Kann dies ebenfalls eine Rechtfertigung für wiederholte Befristungen sein?
Leider nur in sehr engen Grenzen:
Die Grundregel lautet, dass es zu keiner Überwälzung des typischen Unternehmerrisikos auf Arbeitnehmer*innen kommen darf. Kettenbefristungen lassen sich daher nicht damit rechtfertigen, dass man die Arbeitnehmer*innen nur nach Maßgabe der erteilten Aufträge durch Kund*innen beschäftigen könne oder eine unklare Auftragslage bestünde. Befristungen für die Dauer der jeweils aufeinanderfolgenden Kurse – abhängig von der Auftragslage und Kursteilnehmer*innen – sind daher unzulässig, ebenso Kettenbefristungen, die auf die Dauer befristeter (öffentlicher) Aufträge abstellen. Das bedeutet, dass auch die (kurzfristige) Abhängigkeit von Drittmittelfinanzierungen für sich genommen in aller Regel keinen ausreichenden Grund für eine Kettenbefristung darstellt. Wenn die Beschäftigung daher von wiederholten Drittmittelfinanzierungen abhängig ist, die jedoch nicht absehbar sind, ist der Vertrag dennoch unbefristet abzuschließen und dann bei Wegfall der Finanzierung zu kündigen.
Anders ist die Lage bei einem „echten“ Saisonbetrieb: Wiederholte Befristungen nur für die Dauer der jeweiligen Saison sind dann zulässig, wenn tatsächlich für den Betrieb aufgrund äußerer, nicht vom Unternehmen zu steuernden Umständen eine „tote Saison“ besteht – zB bei einem Tournee-Zirkus, der witterungsbedingt nicht das ganze Jahr tätig sein kann. Dasselbe hat etwa auch für Ausstellungs- oder Veranstaltungsräume zu gelten, die nicht winterfest sind und daher ebenfalls nicht ganzjährig genutzt werden können. Wenn aber die vorübergehende Betriebsschließung bzw -einschränkung (zB eines Theaters für die Sommermonate) auf einer selbstbestimmten unternehmerischen Entscheidung beruht und die Aufrechterhaltung des Betriebs für das ganze Jahr an sich möglich wäre, liegt kein echter Saisonbetrieb vor, der eine Kettenbefristung rechtfertigt. Unzulässig war daher die Kettenbefristung einer Billeteurin eines auf Kinder und Jugendliche ausgerichteten Theaterbetriebs, der sich an den Sommerschulferien orientierte und daher in Juli und August geschlossen war, allerdings Bühnentechniker*innen und Verwaltungspersonal weiterbeschäftigte. Eine vom Kulturbetrieb selbstgewählte „Sommerpause“ für das künstlerische Personal, weil etwa aus Erfahrung eine schlechtere Auftragslage im Sommer besteht, wird daher – ohne Hinzukommen weiterer Gründe – in aller Regel keine Rechtfertigung für eine Kettenbefristung darstellen.
Der Spielraum für die Aneinanderreihung befristeter Arbeitsverhältnisse ist daher begrenzt. Eine legitime Ausweichmöglichkeit sind längere Unterbrechungen zwischen den befristeten Arbeitsverträgen, weil dann keine „Kette“ mehr vorliegt. Einen fixen Wert die Dauer der Unterbrechung gibt es aber auch hier nicht. Wie das zuvor genannte Theater-Beispiel zeigt, kann eine Unterbrechung von zwei Monaten zwischen zwei Verträgen bereits zu kurz sein. In aller Regel ist das Risiko einer Kettenbefristung bei Unterbrechungen von mehr als sechs Monaten deutlich minimiert.
Das Risiko einer unzulässigen Kettenbefristung trifft die Arbeitgeber*innen bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses: betroffenen Arbeitnehmer*innen akzeptieren das Befristungsende nicht und berufen sich auf das Vorliegen eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses, das noch weiter aufrecht ist. Das können die Arbeitnehmer*innen auch bei Gericht einklagen. Behördliche Prüfungen zu Kettenbefristungen finden dagegen nicht statt. Arbeitgeber*innen haben dann zwar die Möglichkeit das (unbefristete) Arbeitsverhältnis zu kündigen, müssen aber zum einen über den Befristungsablauf hinaus Entgelt bis zum Kündigungsdatum fortzahlen, und zum anderen besteht das Risiko einer Kündigungsanfechtungsklage. Im Fall einer Kündigungsanfechtung wird der Wegfall der Finanzierung in den meisten Fällen ein ausreichender betrieblicher Kündigungsgrund darstellen, was aber letztlich vom Einzelfall abhängt.
Kulturbetriebe müssen daher beachten, dass Branchenüblichkeit, Drittmittelfinanzierung und laufende Projektarbeit Kettenbefristungen ohne Hinzutreten weiterer sachlicher Gründe in alle Regel nicht rechtfertigen wird, weshalb bei der Aneinanderreihung von befristeten Arbeitsverhältnissen große Vorsicht geboten ist und dies jedenfalls genau geprüft werden sollte – und zwar vor Abschluss des befristeten Arbeitsvertrages.
Andrea Potz
... ist Partnerin und Rechtsanwältin für Arbeitsrecht bei CMS Reich-Rohrwig Hainz Rechtsanwälte GmbH. Sie berät umfassend in allen Bereichen des Arbeitsrechts, wobei sie auf Theater- und Kulturunternehmen sowie für Unternehmen im Bildungssektor, insbesondere Universitäten, spezialisiert ist. Ihr Beratungsschwerpunkt liegt im Bereich Personalführung, Gleichbehandlung und Diversität.