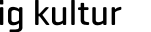Uuund tschüss! Arbeitsbedingungen in Kulturinstitutionen
Auch die regulären Arbeitsverhältnisse sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Zumindest in den Institutionen des Kunstbetriebs – in den (Musik)Theatern, Konzerthäusern, Ausstellungsinstitutionen sowie in der unüberschaubaren Vielzahl an kleineren NGOs – nimmt die Qualität der Arbeitsbedingungen kontinuierlich ab.
Auch die regulären Arbeitsverhältnisse sind nicht mehr das, was sie einmal waren. Zumindest in den Institutionen des Kunstbetriebs – in den (Musik)Theatern, Konzerthäusern, Ausstellungsinstitutionen sowie in der unüberschaubaren Vielzahl an kleineren NGOs – nimmt die Qualität der Arbeitsbedingungen kontinuierlich ab. Dies ist auch wenig erstaunlich, geraten vor dem Hintergrund der Debatte um prekäre Arbeitsverhältnisse die scheinbar weniger prekären „typischen“ Dienstverhältnisse aus dem Blickfeld. In einem laufenden Forschungsprojekt der Universität Innsbruck[1] zum Theaterbereich nennen die Befragten die Sicherheit des Anstellungsverhältnisses als wesentlichen Faktor ihrer Motivation und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Nun ist das zwar nachvollziehbar, denn zweifelsohne wirken Probleme am Arbeitsplatz schnell zweitrangig, wenn dieser selbst dauernd in Gefahr ist. Aber es ist eben doch beunruhigend, wenn arbeitsrechtliche Standards, die seit Jahrzehnten außer Streit zu stehen scheinen, auf einmal munter unterlaufen werden und niemand dagegen protestiert – ja, viele Angestellte dies nicht einmal mehr merken, weil das Wissen um die eigenen Rechte gering ist und die Toleranzgrenzen in einem Umfeld von Unsicherheit und Angst allmählich gestiegen sind.
Entwertung von Arbeit
Der Dienstvertrag allein macht auch schon länger nicht mehr glücklich – spätestens dann nicht, wenn der Blick auf das vereinbarte Gehalt fällt. Denn die Durchschnittsgehälter von Angestellten im Kulturbereich sind wenig berauschend; in Jobanzeigen wird dann gerne von „NGO-üblichen“ Gehältern gesprochen, de facto liegen die Nettogehälter für Teilzeit-Verträge auch für AkademikerInnen und/oder Personen mit langjähriger Berufserfahrung signifikant unter 1.000 Euro. Dass letzteres wieder verstärkt Frauen und MigrantInnen betrifft, wird hier nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Pflichtpraktika und politische Maßnahmen wie die 1-Euro-Jobs in Deutschland tragen ein Weiteres zu einer Entwertung von Kultur- und Wissensarbeit bei.
Erwerbsarbeit bedeutet somit in vielen Fällen nicht mehr die Sicherung der materiellen Lebensgrundlage, sondern bestenfalls eine Möglichkeit für aktives Networking mit Versicherung und Taschengeld. Dementsprechend oft arbeiten „Neue Selbständige“ in Teilzeitjobs, da von der angestellten Arbeit genauso wenig gelebt werden kann wie von der Projektarbeit. Eine Kombination aus schlecht bezahlter Teilzeitarbeit und prekärer Freiberuflichkeit ermöglicht oft ein besseres Auskommen – zumindest in ökonomischer Hinsicht.
Faule Verträge
Neben schlechter Entlohnung finden sich eine schillernde Vielzahl fragwürdiger Vertragskonstrukte, Werk- und freie Dienstverträge sowie geringfügige Anstellungen für Leistungen, die einen regulären Vollzeit-Angestelltenvertrag erfordern würden, Kettenverträge sowie der allseits beliebte Missbrauch von Praktikums- und Traineeplätzen für Dreckarbeit mit Visitkarte. Ein prächtiges Beispiel für diese Entwicklung – nebst Entlohnung unter der Armutsgrenze – ist nach wie vor der Konflikt um die VigilantInnen im Kunsthaus Graz[2]. Besonders pikant ist in diesem Zusammenhang auch das Unverständnis der GPA-DJP (Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck, Journalismus, Papier) jenen ArbeitnehmerInnen gegenüber, die mit einer geradezu anachronistisch wirkenden Zähigkeit an ihren Rechten hängen.
Unseriöse Vertragspraktiken sind im Kunstbereich bedauerlicherweise üblich und machen auch vor Arbeitsverträgen und Betriebsvereinbarungen nicht halt. Beide strotzen oft vor rechtlich unhaltbaren Formulierungen, die allerdings niemand nachprüft oder gar beeinsprucht, weil entweder keine Möglichkeit dazu besteht, oder weil sich viele ohnehin im Glauben wiegen, die Verträge wären korrekt (was eigentlich auch anzunehmen wäre). Und auch hier kommt wieder das Unwissen um die eigenen Rechte zum Tragen bzw. über die Mittel, sich zu wehren. Wie bereits erwähnt, wirkt das Schreckgespenst Prekarisierung disziplinierend: „Insider“ haben Angst wieder zu „Outsidern“ zu werden und die Gewerkschaften, die den ArbeitnehmerInnen den Rücken stärken sollten, haben im Moment offensichtlich wichtigeres zu tun. Deshalb wird gespurt.
Qualität am Arbeitsplatz
Viele spuren und akzeptieren Arbeitsbedingungen, die nach kurzer Zeit sogar ein Leben in prekären Projekten verlockender erscheinen lassen. Denn das Arbeitsklima lässt zu wünschen übrig. Die Palette reicht hier von urheberrechtlichen „Großzügigkeiten“, i.e. Ghostwriting, über alle Facetten des Mobbing bis hin zu einer zunehmend menschenverachtenden Haltung gegenüber Angestellten, die sich wiederum in Verträgen und Betriebsvereinbarungen widerspiegelt – das Sitzverbot für die bereits erwähnten VigilantInnen des Kunsthauses Graz sei hier nur stellvertretend für eine Vielzahl guter Ideen genannt, die Führungskräfte offenbar haben, wenn der Tag lang ist. So willkürliche wie sinnlose Ge- und Verbote, die primär den Zweck haben, die Allmacht der jeweiligen Leitung vorzuführen, prägen den Arbeitsalltag. „Personalentwicklungsmaßnahmen“, wie es so schön heißt, also Fortbildungsmaßnahmen etc., verkommen zur Gnadenleistung bzw. werden überhaupt unterlassen. Arbeitszeitgrenzen werden genauso wenig respektiert wie in der Projektarbeit, kurzfristig verordnete Wochenend- und Nachtschichten gehören dazu, ebenso wie der Einsatz privater Arbeitsmittel (vom Handy bis zum Laptop). Urlaubszeiten müssen erbettelt werden, Überstunden werden oft schlicht nicht bezahlt. Allein schon der Versuch, grundlegende Rechte durchzusetzen, kostet oft den Job.
Ein schlechtes Arbeitsklima sowie die bunten Schattierungen von Mobbing tun das ihrige, um für eine hohe Personalfluktuation zu sorgen. Letzteres ist auch ein nützliches Instrument, um Entlassungen vorzubeugen, die nach wie vor unbeliebt sind, und im Zweifelsfall sogar den FördergeberInnen der ja zumeist voll öffentlich finanzierten Institutionen auffallen könnten. Geschickter ist hier schon ein allmähliches Zermürben und Austreiben von Angestellten, was umso leichter ist, je instabiler die übrigen Lebensumstände der betroffenen Person sind.
Stumpfe gewerkschaftliche Instrumente
BetriebsrätInnen sind zu stumpfe Instrumente, um sich zur Wehr zu setzen. Denn einerseits erreichen viele Institutionen erst gar nicht die kritische Größe, um eine Betriebsrätin/einen Betriebsrat aufstellen zu können, und andererseits ermöglicht der Einspruch im Kündigungsfall den Gang zum Gericht, was aber wiederum nur selten in Anspruch genommen wird, da ein derartiger Prozess angesichts der geringen Löhne wenig verlockend ist. In den wenigen Großbetrieben, wo die Wahl einer Betriebsrätin/eines Betriebsrates möglich ist, wird dies oft über Jahre verhindert (wie es im Leopold Museum[3] oder im Rupertinum unter der Leitung von Agnes Husslein[4] der Fall war).
Die gewerkschaftlichen Mittel, die Angestellten zur Verfügung stehen, sind auf Großbetriebe und einen integrierten Arbeitsmarkt zugeschnitten, funktionieren im informellen Kulturbetrieb eines kleinen Landes nur bedingt oder gar nicht. Denn: Jede-kennt-jeden und der Ruf ist schnell ruiniert. Da die Jobvergabe auch in den großen Kulturinstitutionen – bis auf wenige Ausnahmen, wo Ausschreibungspflichten gar nicht umgangen werden können – freihändig über private Netzwerke und Insiderinformationen erfolgt, sollte sich niemand unbeliebt machen (der universitäre Arbeitsmarkt funktioniert in dieser Hinsicht übrigens gleich). Die Gewerkschaften haben es bisher versäumt, adäquate Instrumente für informelle Arbeitsmärkte wie den Kunst- und Kulturbereich zu entwickeln, was aber angesichts ihrer zunehmenden Bedeutungslosigkeit in diesem Sektor mittlerweile auch schon egal ist.
Prekäre Fixanstellung
Es erübrigt sich fast darauf hinzuweisen, dass bestehende Diskriminierungsstrukturen durch derartige Arbeitsverhältnisse verstärkt werden – wie auch unter den prekär lebenden Neuen Selbständigen sind es auch im scheinbar gesicherten Bereich Frauen und MigrantInnen, die am verwundbarsten sind. Aus diesem Grund verfallen gerade Frauen (Männer schon seltener) mit Kindern oft auf die trügerische Annahme, dass eine selbständige Tätigkeit leichter mit den Betreuungsaufgaben zu vereinbaren wäre; ein Trugschluss, wie sich für die meisten bald herausstellt.
Als Fazit lässt sich feststellen, dass sich die Arbeitsbedingungen auch in Kulturbetrieben, die eine vergleichsweise hohe Stabilität aufweisen wie Theater und/oder Museen, an jene angleichen, wie sie in prekärer Projektarbeit bekannt sind: Überbordernde Arbeitszeiten, verschwimmende Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben, geringe Löhne und zunehmende Unsicherheit. Dazu kommen noch steile innerbetriebliche Hierarchien und die Weisungsgebundenheit, die die Vorteile der relativen Planungssicherheit bei unbefristeten Verträgen sowie die Versicherungsleistungen stark relativieren. Immer öfter findet sich auch das im akademischen Bereich beliebte Modell der eigenen Arbeitsplatzbeschaffung wieder: Personen schreiben Projektanträge (in vielen Fällen unbezahlt) und im Falle einer Bewilligung werden sie über eben dieses Projekt angestellt; oder in manchen Extremfällen auch nicht – das Risiko trägt eins selbst. Langfristige Perspektiven sind somit nicht möglich und die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz wird in die aktive Eigenverantwortung der hoffnungsvollen JobaspirantInnen gelegt.
Kontinuität von Beschäftigung sowie die Sorge um Qualität am Arbeitsplatz wird in den meisten Institutionen nicht mehr als eine betriebliche Kernaufgabe gesehen, sondern ausgelagert und verdrängt. Eine dringend notwendige Debatte darüber wird angesichts der um sich greifenden Prekarisierung überlagert. Die Folge ist, dass die stetig sinkende Zahl an Angestellten im Kulturbereich unter zusehends unerträglicheren Bedingungen arbeiten, was der Qualität abträglich ist und immer schlechter von PR-Maßnahmen übertüncht werden kann. Angesichts der Tatsache, dass es sich hierbei um öffentliche Gelder handelt, steht eine öffentliche Diskussion um die Arbeitsqualität innerhalb der Institutionen dringend an.
1 Für nähere Informationen siehe das Projekt von Dagmar Abfalter: „Das Unmessbare messen? Die Konstruktion von Erfolg im Musiktheater“, Institut für Strategisches Management, Marketing & Tourismus der Universität Innsbruck, strategic-management.at
2 vgl. Huber, Laila: „Resistance is fertile :: resistance is futile“. In: Kulturrisse 01/2007, S. 40-43
3 vgl.augustin
4 vgl. derStandard
Elisabeth Mayerhofer ist Mitglied der Forschungsgesellschaft für kulturökonomische und kulturpolitische Studien (FOKUS).