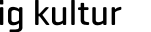Steigende Flut des Widerspruchs. Museen im Zeitalter des expandierenden Workfare-Staats
Die Kritik beginnt damit, die heute fast abgeschlossene “Krise des Wohlfahrtsstaats” zu verstehen. Denn fälschlicherweise wird ihr Ursprung dem neoliberalen Herrschaftswechsel, der Mitte der 1970er Jahre mit der Chicago-Schule der Ökonomie und Thatchers konservativer Revolution begann, zugeschrieben. Doch das war nur die zweite Phase.
Stellen Sie sich ein sechsstöckiges Multiplexgebäude vor, mit Eingangs- und Kassenbereich, Kinos, Konferenzsälen und Veranstaltungshallen, Medien- und Informationszentren, Bibliotheken, Buch- und Geschenkartikelläden, Cafeteria, Restaurant, Bar und natürlich auch Ausstellungsräumen: das Centre Pompidou in Paris. Verteilen Sie diese Funktionen in einem riesigen Innenhof, mit mehreren Gebäuden und allen Attraktionen einer architektonischen Promenade: das Museumsquartier in Wien. Verstreuen Sie diese weiter in einer renovierten Stadt, deren traditionelle Feste und deren zeitgenössisches intellektuelles Leben zu Veranstaltungen im Tourismuskalender umprogrammiert werden: die gesamte Stadt Barcelona. Der Wohlfahrtsstaat mag zwar schrumpfen, sicherlich aber nicht das Museum. Letzteres befindet sich eher in einem Prozess der Fragmentierung, dringt immer tiefer und organischer ein in das komplexe Geflecht semiotischer Produktion. Seine Nebenprodukte wie Design, Mode, Multimediaspektakel, aber auch Beziehungstechnologien und über den Museumsbetrieb hinausgehendes Consulting gehören zu den treibenden Kräften heutiger Ökonomie. Von der modernistischen Auffassung des Museums als Sammlung großer Werke, die als öffentliche Dienstleistung ausgestellt werden, sind wir weit entfernt. Stattdessen sprechen wir über aktive Laboratorien sozialer Entwicklung. Wir sprechen von arbeitenden Museen, von Museen, die Teil der herrschenden Ökonomie sind und sich mit zunehmender, durch Staat und Markt auferlegter Geschwindigkeit verändern. Ist es unmöglich, diese gewaltige Entwicklung kultureller Aktivität für irgend etwas anderes zu nutzen als für die Förderung von Tourismus, Konsum und die schubweise Abfertigung der Aufmerksamkeit und des Gefühls von Menschen? Die Antwort hängt vom Vorhandensein zweier schwer fassbarer Grundvoraussetzungen ab: einer Praxis der Konfrontation und konstruktiver Kritik.
Die Kritik beginnt damit, die heute fast abgeschlossene “Krise des Wohlfahrtsstaats” zu verstehen. Denn fälschlicherweise wird ihr Ursprung dem neoliberalen Herrschaftswechsel, der Mitte der 1970er Jahre mit der Chicago-Schule der Ökonomie und Thatchers konservativer Revolution begann, zugeschrieben. Doch das war nur die zweite Phase. Die Kulturkritik der 1960er Jahre war durch und durch antibürokratisch. Sie wollte die industriellen Hierarchien, die auch das intimste Sein bestimmten, auflösen, was der Anthropologe Pierre Clastres in der Phrase “Gesellschaft gegen den Staat” zusammenfasste. Und hier fanden die Neoliberalen ihre Chance: Sie verbanden den Wechsel ökonomischer Organisation (modulares Management semi- oder pseudoautonomer Profitzentren gegen jede vertikale Integration) mit einer ambitionierten neuen Sozialpolitik (Mobilisierung der Arbeitskraft nicht durch das Versprechen sozialer Sicherheiten, sondern durch die persönliche Verwicklung von Leidenschaft, Ethik und Subjektivität). Die Imagination übernimmt das Kommando, über der schwindenden Bedeutung der Mechanisierung und über sie hinaus, während die soziale Wohlfahrt (die Garantie einer gewissen “Freizeit” abseits der Maschine) durch Workfare (das Rezept für die totale Mobilisierung der Bevölkerung) ersetzt wird. Kunst, oder allgemeiner “Kreativität”, ist in dieser finanzdominierten Ära der Bild- und Zeichenproduktion zum zentralen Punkt des Workfare-Systems geworden, sowohl Ikone wie Einschlussverfahren für die heutige Gesellschaft, und mit dem Versuch, alle permanent zu einem noch höheren Aktivitätsgrad anzutreiben. Oder sie an den Rand zu drängen, wenn sie nicht dazu gebracht werden können, sich anzupassen. Auf diese Weise zeugt das kulturelle Multiplex von einer Hegel'schen List der Geschichte. Mitten in der Überfülle kommerzialisierter Ästhetik wurde die individuelle Revolte früherer Generationen integriert als Trägerin und Maske repressiven Ausschlusses. Allerdings werden wir diesem Schicksal nicht durch die Rückkehr zu staatlicher Bürokratie und zum religiös-stillen modernistischen Museum entkommen. Stattdessen muss eine radikal andere Form der Gouvernmentalität erfunden werden, durch die, wie Foucault sagt, freie Subjekte versuchen, “das Verhalten anderer zu lenken”.
Woraus besteht eine Praxis der Konfrontation heute? Aus der autonomen, bewusst ineffizienten und regelwidrigen Produktion ästhetischer Mittel, welche die aufmerksamkeitslenkenden Techniken, die das Zusammenwirken von Workfare-Staat und Konzernkapital hervorgebracht hat, stören und zum Entgleisen bringen. Die Mayday Parades der flexibilisierten ArbeiterInnen, die in Mailand erfunden wurden und nun auch in Barcelona stattfinden, sind dafür beispielhaft. Beginnend bei den auf vielfältige Weise Ausgeschlossenen – Sans-Papiers, Arbeitslosen, der HausbesetzerInnen-Bewegung, Menschen ohne die diversen Versicherungen und jenen ohne jede Möglichkeit auf Tarifverhandlungen – versuchen sie, politisches Bewusstsein für die Lebens- und Arbeitssituation zu schaffen und greifen die typischen Unterdrückungs- und Ausbeutungsformen an. Ihre Mittel sind natürlich ästhetische, denn so “lenken” die Mitglieder unserer Gesellschaften - zumindest in den relativ geschützten Machtzentren - “das Verhalten anderer”. Aber das ist eine Ästhetik des Karnevals, des Chaos. Die Mayday Parades nützen kooperative, auf Solidarität gestützte Organisationsformen für die Mobilisierung der Energien Gleichgesinnter in einer chaotischen Konfrontation mit den genauestens durchkalkulierten Bildern, Marken und Tourismuslandschaften, die unsere Handlungen lenken und leiten, um jede politische Rede zu verhindern. Das Bild der TänzerInnen, die in pinkfarbenen Federkleidern ausdrucksvoll den Geschäftsgang eines Zara-Ladens in Mailand stören, fasst diesen neuen Kampf perfekt zusammen. Ebenso wie das spanische Video “Desmantelando Indra”, das eine Gruppe von Demonstrierenden, die wie WaffeninspektorInnen gekleidet sind, beim Betreten des Büros einer Waffenfabrik zeigt, gefolgt von der Demontage der gesamten Kommunikations- und Computerausrüstung, die in verschlossenen Kartons mit dem Aufdruck: “Achtung: Massenvernichtungswaffen” zurückgelassen werden (http://www.sindo minio.net/mapas/es/accions_es.htm). Genau das wird durch die “Massentäuschungswaffen” der Modeindustrie verschleiert: Kommunikation und korporative Formen sozialer Organisation als tödliche Waffen in einem Bürgerkrieg. Worum es geht, ist die Dekonstruktion der Kriegsökonomie und die Schaffung einer kollektiven Basis für freie Formen offener Kooperation (alternative Formen des Wohnens, von Versicherung, Verkehr und Arbeit, neue Formen des vergesellschafteten Zugangs zu Kommunikation, Copyleft-Rechte auf allgemeine Güter, die Erfindung kollektiver Eigentumsformen, die Ausweitung von Subsidiarität und direkter demokratischer Prozesse). Und der Notfall-Aktivismus im Mayday-Stil ist nur die sichtbarste Gestalt neuer experimenteller Räume der Konfrontation. Aber rund um uns sind in bescheidenerer, langsamerer und dezenterer Form ähnliche Energien aktiv, wo auf subtileren, weicheren und intimeren Ebenen das Psychische, Künstlerische und Politische zusammentreffen.
Was könnte das Museum zu dieser Art von ästhetischem Aktivismus beitragen? Erstens seine Genealogie, die in einer ungebrochenen Linie von den frühesten dadaistischen Experimenten (die mitten im Gemetzel des ersten Weltkriegs entwickelt wurden) bis zur Folge von Installationspraxen, Happenings, Konzeptkunst, situationistischer Intervention (die wiederum mitten im Vietnamkrieg und dem Aufruhr der 68er-Bewegungen entwickelt wurden) führt: eine Genealogie der Kunst, die über sich selbst hinausgehen will, eine Kunst für die Außenwelt. Zweitens aber kann das Museum sich für die Diskussion von aktivistischen Formen öffnen, die nicht als tote Körper der Vergangenheit für die akademische Analyse dienen sollen, sondern als Inspiration und Referenzpunkte für die Entwicklung neuer Praxen in unmittelbarer Zukunft. Statt einer Ansammlung nutzlosen modernen Wissens auch noch die neuesten Stimulatoren der Konsummotivierung aufzupfropfen, wird die Post-Workfare-Institution ein sinnlicher Lernraum für Alternativen zur totalen kapitalistischen Mobilisierung der Gesellschaft: ein Archiv, das nicht Ruhe von seinen BenützerInnen fordert. Drittens projiziert es bestimmte Ressourcen über seine Mauern hinweg nach außen, um damit an Experiment und Austausch teilzunehmen innerhalb der Textur miteinander konkurrierender Ästhetiken, die die heutige Stadt ausmachen. Es sammelt die Spuren dieser und anderer autonomer Aktivitäten. Es verbindet die physischen ebenso wie die elektronischen Räume, in denen solche Spuren zum Gegenstand einer offenen, nach vorn blickenden Diskussion werden können. So hilft es, das Anliegen der meisten zeitgenössischen Kunstformen zu erfüllen, all die Ansprüche, ein Miniaturmodell sozialer Interaktion und gleichzeitig ein unbestimmtes Feld für ihre Neuerfindung zu sein. Weder sterilisiert es dieses Versprechen innerhalb exklusiver, in starkem Ausmaß klassenbestimmter Grenzen, noch reduziert es seine Produktion auf Objekte der Kontemplation. Es nimmt die grundlegenden gesellschaftlichen Konflikte wahr und beteiligt sich an riskanten Prozessen, die helfen können, diese Konflikte aus der Sackgasse der Gewalt zu befreien und sie auf eine politische Ebene zu verlagern, wo Gleiche mit Gleichen konfrontiert sind - eine Ebene, auf der Gouvernementalität ein kollektiver Ansatz ist. Darin besteht die Funktion der öffentlichen Dienstleistung der neuen “Museen”. Beispielhaft wird das von einer Mikroinstitution wie Public Netbase erfüllt, vor allem in den eben auf dem Wiener Karlsplatz stattfindenden Container-Aktivitäten und in deren elektronischen Echos. Aber diese Funktion existiert auch als Virtualität, im Begehren tausender AkteurInnen in den Institutionen, die enttäuscht und empört sind von der Wirkung der kulturellen Multiplexe und vom gescheiterten Modell öffentlicher Dienstleistung im Wohlfahrtsstaat.
Wie kann das Virtuelle real werden? Woran es an diesem Punkt fehlt, ist weniger die künstlerische Praxis, als eine starke Kritik, die Wert- und Entscheidungskriterien in die öffentliche und professionelle Diskussion einschreibt. Auch nach fünf Jahren intensivsten sozialen und künstlerischen Aktivismus' müssen wir erst eine konstruktive Kritik entwickeln. Die Kritik der Zeitschriften und KuratorInnen bleibt pathetisch unterwürfig (nach Marcuse “affirmativ”), während minoritäre Entwicklungen entweder in der Falle der Desillusion und der zynischen Beobachtung der Katastrophe gefangen bleiben oder in der kaum vorzuziehenden Sackgasse puren Radikalismus' und der Verweigerung von allem, was nach Kooptierung riecht. Es ist richtig, dass Kritik ebenso wie die Praxis der Konfrontation immer die Wareneigenschaft annehmen muss, wenn sie innerhalb der Grenzen des institutionellen Markts akzeptiert wird. Das ist wahrlich ein Problem. Aber Kooptierung ist auch eine offene Front des sozialen Kampfs. Die Annahme, dieser Kampf könne durch die Mahnung zu reinen Formen demokratischer Diskussion und kommunikativer Vernunft (Habermas) gewonnen werden, hat sich als ebenso illusorisch herausgestellt wie die perversen Hoffnungen auf die Fähigkeit des Markts, die Wünsche des Volks zu übersetzen (Cultural Studies). Es gibt keine “Lösung” für eine linke kulturelle Position innerhalb einer Marktgesellschaft, nur eine fortwährende Spannung zwischen den AkteurInnen innerhalb und außerhalb der Institutionen, an der oft überschrittenen Grenze ihrer Dehnbarkeit; eine ständige problematische Bewegung zwischen “Situationen des Widerstands” und “Situationen des Managements”, wie das Diego Stzulwark und Miguel Benasayag einst bezeichneten, scheint heute – gefangen in ihrem unauflöslichen Widerspruch - die einzige Möglichkeit zu bieten, etwas mit der Fülle ästhetischer Institutionen anzufangen, die von der steigenden Flut des heutigen Workfare-Staats eingeschlossen sind.
Brian Holmes ist Aktivist und Kunstkritiker, lebt in Paris. Der Text ist zuerst erschienen im multilingualen Webjournal von www.republicart.net, wo sich unter dem Titel institution weitere Texte zum Thema finden.