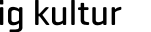"Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit". Anmerkungen zur Tagung "Nachrichten aus Demokratien"
„Nachrichten aus Demokratien. Feministische Positionen und Auseinandersetzungen“ – so lautetet der Titel einer vom Verein für feministische Bildung, Kultur und Politik „Frauenhetz“ veranstalteten Tagung, die von 26. – 29.10. 2006 in Wien stattfand. Aus politisch-theoretischen, ökonomischen, historischen, soziologischen, philosophischen, postkolonialen und psychoanalytischen Perspektiven wurden in Vorträgen und Workshops feministische Kritik und Möglichkeiten der Demokratie diskutiert.
„Nachrichten aus Demokratien. Feministische Positionen und Auseinandersetzungen“ – so lautetet der Titel einer vom Verein für feministische Bildung, Kultur und Politik „Frauenhetz“ veranstalteten Tagung, die von 26. – 29.10. 2006 in Wien stattfand. Aus politisch-theoretischen, ökonomischen, historischen, soziologischen, philosophischen, postkolonialen und psychoanalytischen Perspektiven wurden in Vorträgen und Workshops feministische Kritik und Möglichkeiten der Demokratie diskutiert. Im Eröffnungsvortrag „Pluralist democracy and agonistic politics“ von Chantal Mouffe (Westminster Universität, London) wurde Demokratie auch als Möglichkeit vorgestellt, Räume für Diskussionen und Kontroversen zu eröffnen und/oder lebendig zu halten. Vor diesem Hintergrund möchte ich nicht nur die gegenwärtigen feministischen demokratietheoretischen und -politischen Diskussionen der Tagung wiedergeben, sondern vielmehr diese selbst als Lehrstück betrachten, aus dem sich zumindest einige jener Fragen entnehmen lassen, denen ein feministisch-demokratisches Verständnis des Politischen in den gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnissen gerecht werden muss. Die Antwort auf die Frage nach dem Eintritt von Frauen in die Demokratie verortete Gerburg Treusch-Dieter (TU/UdK Berlin) in ihrem Vortrag in den Hexenprozessen. In ihrer Analyse der Entwicklung westlich-patriarchaler Strukturen der Demokratie argumentiert Treusch-Dieter, dass „das Weibliche“ als „hexisches“ und später „hysterisches“ das feindliche Gegenüber des vernünftigen Staates darstelle, der als demokratisch verfasster immer die Existenz eines „inneren Feindes“ voraussetze. Aus der Perspektive des auf „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit“ fußenden patriarchalen Staates würde die innere Bedrohung auf das Weibliche fixiert, welches aus dem Inneren der Gesellschaft kommt und das, bevor es ausbricht, unterdrückt werden müsse. Der Eintritt der Frauen in die existierende formale Demokratie sei demnach nur als „symbolisch Kastrierte“ möglich. Selbstherrschaft des Volkes wird so bei Treusch-Dieter zur Beherrschung des als feindlich Konstruierten, was auch die als nach innen genommene Fremdherrschaft beinhalte. Ausschluss, Antagonismus und Herrschaft seien essenzielle Bestandteile der formalen Demokratie, weshalb feministische Kritik die radikale Neubestimmung von Demokratie bedeute, was auch die Veränderung der kapitalistischen und nationalstaatlichen Rahmenbedingungen von Demokratie umfasst.
Im Gegensatz dazu hob Chantal Mouffe in ihrem Beitrag die sich aus dem agonistischen Charakter der Gesellschaft ergebenden Chancen für eine plurale Demokratie hervor. Agonismen sind nach Mouffe Gegensätze, die allerdings immer noch einen symbolischen Rahmen teilen und nebeneinander bestehen können und im Gegensatz zu Antagonismen daher nicht auf die jeweilige Vernichtung des/der Anderen abzielen. Da die Opposition von „wir“ und den „anderen“ konstitutiv für das Politische sei, leitet Mouffe die Anerkennung der gesellschaftlichen Agonismen als Bedingung für das Modell der radikalen Demokratie ab.
Mit den Beiträgen von Treusch-Dieter und Mouffe ist der Bogen über die Breite der gegenwärtigen demokratietheoretischen Debatten gespannt: Während Treusch-Dieters Impetus den Schriftzug radikaler feministischer Ansätze trägt, die mit Feminismus den Anspruch verbinden, die gesamtgesellschaftlichen Strukturen von ihren Wurzeln her zu transformieren, besteht bei Mouffe die Radikalität in der Anerkennung der Pluralität und der Agonismen.
Gleichsam quer dazu warfen Maria do Mar Castro Varela und Nikita Dhawan (Universität Oldenburg), die gleich zu Beginn ihres Vortrags ihre eigene migrantische Herkunft thematisierten, die These auf, dass über Demokratie nicht gesprochen werden kann, ohne über Dekolonialisierung zu sprechen. Denn durch das Miteinbeziehen postkolonialer Kritik würde sichtbar, dass Demokratie nicht nur auf vergeschlechtlichten Exklusionsmechanismen basiert, sondern dass diese mit rassisierenden und ethnisierenden Herrschaftsstrukturen verwoben sind, die innerhalb der „symbolisch kastrierten Frauen“ die Kastrationsmechanismen fortsetzen und vervielfältigen. Vor diesem Hintergrund betonten die Vortragenden zum einen die Notwendigkeit der Politisierung der differenten Subjektpositionierungen als Voraussetzung eines gemeinsamen feministischen Handelns und zum anderen die Bedeutung des Bewusstseins um die jeweils eigene Verwobenheit in gesellschaftliche Machtstrukturen. Damit zielt die postkoloniale feministische Kritik auch auf eine Erweiterung des Politikverständnisses, da Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die in die eigene Subjektposition und damit in die alltäglichen Erfahrungen eingehen und in diesen reproduziert werden, Teil und Voraussetzung des Politischen sind.
Ein feministisches demokratiepolitisches Lehrstück …
Wie es mit dem Zusammenhang von Demokratie und Feminismus aus der Innenperspektive der demokratiepolitischen Alltagserfahrungen aussieht, lässt sich aus dem Eintritt der migrantischen / postkolonialen Position in die feministische Debatte auf der Tagung selbst ablesen. Dieser Eintritt der „nicht-weißen“ Subjektposition in die Demokratie rief überaus kontroverse Reaktionen hervor, die in Anlehnung an Mouffe eher als antagonistisch denn als agonistisch bezeichnet werden können, da der gemeinsame symbolische Raum nicht mehr erkennbar war. Vielmehr folgte der Konstruktion der „fremden Feindin“ die Gegenüberstellung – mit der Konsequenz der „Vernichtung“ der einen Seite.
Die Diskussionen, die sich an den Impulsen aus der postkolonialen und antirassistischen Perspektive entspannen, könnten verkürzt als Ausdruck eines Generationenkonflikts zwischen „Differenzfeministinnen“ und „Poststrukturalistinnen“ um die Definitionsmacht „des“ Feminismus abgebildet werden. Ein derartiger Blick allerdings würde die nachfolgenden Aspekte unsichtbar lassen, die als Kernstück des Lehrstücks, was Demokratie als Lebensform innerhalb feministischer Zusammenhänge bedeutet, betrachtet werden können. Dies wird nicht zuletzt deshalb in der Retrospektive bedeutsam, weil auf der Tagung selbst die Frage nach der Demokratie als (mögliche) feministische Lebensform zumeist neben der Auseinandersetzung mit der Demokratie als Regierungsform verschwand.
Castro Varela und Dhawan stellten als eine der Kernaussagen der postkolonialen feministischen Theorie die Politisierung der Frage vor, von welcher Position aus die einzelnen Subjekte in die Demokratie eintreten. Da Macht-, Hierarchie- und Herrschaftsverhältnisse durch die einzelnen Subjekte und also auch durch „die“ Frauen gehen, wodurch sich diese daher auch an der Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse beteiligen, wird das Miteinbeziehen der eigenen Subjektposition zu einer zentralen Bedingung von feministischem Denken und Handeln, das die Selbstreflexion der eigenen Position und die Selbstkritik notwendig umfasst. Das Ankommen in Demokratien setzt somit auch das Ankommen in der Einsicht voraus, in die Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse eingebunden zu sein. Dies bedeutet für weiße, westliche Feministinnen, ihre eigene Beteiligung an den rassisierten Ausbeutungsstrukturen im Nord-Süd-Gefälle genau so wie an kulturellen Ausschlussmechanismen zu reflektieren und zu akzeptieren, dass das „Wir“ zwischen Feministinnen ethnisch gebrochen ist.
Diese Problematisierung durch die migrantische Position des in (feministisch-) demokratischen Diskussionen gesetzten „Wir“ wurde – so meine Interpretation – auf der Tagung von Seiten vieler Mehrheitsösterreicherinnen jedoch als Zurückweisung aufgefasst, wodurch der Blick auf die Notwendigkeit der Selbstkritik verstellt wurde. Weitergedacht setzt sich durch diese Weigerung der mehrheitsösterreichischen Feministinnen, auch ihre eigene Mittäterinnenschaft an der Reproduktion rassistischer Ausbeutung und Ausschlüsse zu denken, paradoxerweise die Eigenwahrnehmung der (weißen) Frauen als Opfer fort, die bereits in den 1980er Jahren innerhalb des Feminismus kritisiert wurde. Darüber hinaus wird damit auch der Blick auf das nicht-weiße Gegenüber als eigenständiges Subjekt verwehrt, das sich aus dem – auch innerhalb der feministischen Bewegung für sie angefertigten – Passepartout der hilfebedürftigen Migrantin/Nicht-Weißen befreit hat.
Der Kampf, der gegen die Sichtbarmachung der Differenzierung der Subjektpositionen geführt wird, erinnert in seiner Sprache und Form an feministische Kämpfe gegen den „äußeren Feind“ des Patriarchats, der sich gegenwärtig so diffus und subtil zugleich zeigt. Vor diesem Hintergrund erhält die These Berechtigung, diese Diskussionen und Kontroversen auch als Zeichen von Ohnmacht zu fassen, die uns unter den gegenwärtigen neoliberalen Umbauprozessen umgibt. Diese wird allerdings nach innen gewendet und führt so zu Grabenkämpfen innerhalb des Feminismus, welche die Ohnmacht nach außen noch vergrößern. Tove Soiland (Zürich) verglich in der Abschlussrunde die gegenwärtige Situation innerhalb der feministischen Theorie und Bewegung mit jener der Linken in den 1920er Jahren, die mit dem Bekämpfen der jeweils anderen internen Position beschäftigt waren, weil sie sich die (scheinbare) Unmöglichkeit des Handelns nicht eingestehen konnten – während die FaschistInnen bereits ihre Bürotüren zertrümmerten.
Resümee
Angesichts dieser Erfahrungen aus dem Lehrstück der Tagung, dass das feministische „Wir“ nur als gebrochenes gedacht werden kann und dass das Eingelassensein aller Subjekte in die bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse die Notwendigkeit der Reflexion der eigenen Subjektposition zur Voraussetzung politischen Handelns macht, bleibt die Frage, wie ein kritisches feministisches Verständnis von Demokratie sich denken lässt? Die Rahmenbedingungen dafür sind denkbar schlecht: Die gegenwärtige Aus- und Unterhöhlung des Rechtsstaates, wie sie sich insbesondere aus dem aktuellen Fremdenrechtspaket ablesen lässt, machen die Verteidigung jener Institutionen notwendig, die noch vor zwanzig Jahren als patriarchal strukturierte zum Ziel feministischer Kritik wurden. Betrachtet man zudem die neoliberalen Anrufungen und Lebensbedingungen, lässt sich erkennen, dass viele ursprünglich kritische Forderungen angeeignet wurden und Eingang gefunden haben in gegenwärtige Regierungstechniken.
Die Antwort von Chantal Mouffe halte ich deshalb für unzureichend bei der Suche nach einem angemessenen emanzipatorischen Verständnis von Demokratie. Denn das Ziel von Demokratie besteht bei Mouffe in der Anerkennung der agonistischen Positionen. Dies setzt jedoch gesellschaftliche Strukturen voraus, die differente und hierarchisch angeordnete Subjektpositionen erst hervor bringen, die nicht mehr politisiert werden. Stattdessen möchte ich nochmals den Faden aufnehmen, den Gerburg Treusch-Dieter gegeben hat, und diesen weiter spinnen für die Frage um eine feministisch-demokratische Positionierung: Von ihrer Kritik an der demokratischen Losung von „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ ausgehend fordert sie eine radikale Erneuerung von Demokratie.
In diesem Sinne könnte die Idee von „Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit“ als Wegbestimmung von Demokratie fungieren. Die Basis dieser Schwesterlichkeit wäre dann allerdings nicht die Annahme einer „globalen Schwesterlichkeit“ im Sinne der Vereinheitlichung, sondern die gemeinsame Kritik an strukturellen Unterdrückungsformen. Dies eröffnet die Möglichkeit für Allianzen mit dissidenten Positionen, die zugleich konflikthaft gedacht werden können, ohne den Eingang von Konflikten in das Politische als essentiell zu setzen. Demnach wäre Demokratie – als Möglichkeit konflikthafter Allianzen – der Weg und nicht der Zweck des Politischen. Umgekehrt wäre die Abwesenheit von Differenz nicht der Ausgangspunkt, wie dies unter den gegenwärtigen Verhältnissen nur als dessen Verleugnung möglich wäre, sondern die utopische Vorstellung am Horizont. Zum anderen könnte – von Treusch-Dieters Kritik ausgehend – „Schwesterlichkeit“ meinen, dass feministische Kritik als gesamtgesellschaftliche Kritik wirksam ist und auf die radikale Veränderung aller bestehenden Strukturen abzielt.
Anmerkung
Der Titel dieses Artikels geht auf Gerburg Treusch-Dieter zurück, die am 19.November 2006 gestorben ist – mit Dank für ihre Anregungen für kritisches und engagiertes feministisches Denken und Handeln.
Gundula Ludwig beschäftigt sich u.a. mit Demokratietheorien und der Politik der Geschlechterverhältnisse und ist derzeit Assistentin in Ausbildung am Institut für Politikwissenschaft an der Universität Wien.