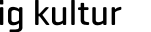Freifach Musik
Wie dürfen wir ein Abdriften in eine "Welt der Geister" im Zusammenhang mit Kunst- und Kulturproduktionen von MigrantInnen verstehen? Und warum treten der Balkan und Afrika in Form von Musik produzierenden Geistern in Erscheinung?
Ende Oktober 2004 fand in der Wiener Hauptbücherei die Veranstaltung "subtitle: Kulturproduktion von Minderheiten zwischen Ethnisierung und Politik" (siehe Review von Kien Nghi Ha in den letzten Kulturrissen) statt. Neben Film, bildender Kunst und Literatur stand auch "Balkanjazz" als Beispiel für eine "musikalische Ausdrucksform der Grenzüberschreitung" im Zentrum eines Panels. Der Titel versprach, auch in Österreich bei Diskussionen in emanzipatorischen Zusammenhängen Popmusik in den Rang der diskursfähigen Kunst- und Kultursparten aufzunehmen. Allerdings stellte sich kurz nach dem Beginn der Veranstaltung eine nachhaltige Verärgerung ein. Das Panel bot leider einmal mehr die Gelegenheit, Zeugin/Zeuge einer Diskussion zu werden, die es nicht schaffte, Popmusik als ein politisches Feld zu diskutieren, in dem ein Kampf um Hegemonie stattfindet. Statt dessen war es ein Austausch an unüberlegten und zum Teil rassistischen Statements.
Harald Huber (Popularmusikforscher und Musiker) nahm die Einladung auf das Podium zum Anlass, um sich der Entstehungsgeschichte des so genannten "Balkanjazz" zu widmen: Im 20. Jahrhundert hätten sich die "Geister des Balkans" und die "Geister Afrikas" getroffen, um neue musikalische Formen entstehen zu lassen. Aus einer Mischung von afrikanischer Trommelmusik, Jazz und den Charakteristika der Musik aus dem Balkan sei "Balkanjazz" entstanden.
Wie dürfen wir ein Abdriften in eine "Welt der Geister" im Zusammenhang mit Kunst- und Kulturproduktionen von MigrantInnen verstehen? Und warum treten der Balkan und Afrika in Form von Musik produzierenden Geistern in Erscheinung?
Der Balkan und Afrika sind spätestens seit dem 19. Jahrhundert Projektionsflächen für das Andere, das Fremde, das Exotische. Die "Geister des Balkans" und die "Geister Afrikas" werden bei dem Versuch, die Entstehungsgeschichte des "Balkanjazz" nachzuzeichnen, zum "Orient" oder – wie Huber es ausdrückte – zu "non-western sources". Der "Okzident" hingegen ist das Zentrum und setzt sich als Subjekt. Dieser eurozentristische Blick offenbarte sich auch deutlich an Hubers Definition von World Music. World Music ist "eine Musik, die außerhalb der nord-westlichen Hemisphäre beheimatet ist und wahrgenommen wird". Die Setzung eines Subjekts, das ein Objekt, in diesem Fall den "Balkanjazz", erkennt, geht mit Klassifizierungs- und Abwertungsprozessen einher, die dem Westen ein spezifisches Identitätsgefühl geben: Westliche Menschen begreifen sich als rational, liberal und logisch denkend; allen Anderen werden diese Eigenschaften konsequent abgesprochen. In den Diskursen über Popmusik manifestiert sich dieser "Vorgang des Orientalisierens" (Edward Said) durch Zuschreibungen von obszöner Körperlichkeit, Wildheit, Temperament und niedriger Intelligenz. All diese Attribute sind implizit bei der Unterscheidung in ein Wir und die Anderen anwesend, deren "Musik außerhalb des Westen beheimatet ist", und sie finden sich gemeinhin bei Popmusiken aus dem Balkan, bei afrikanischer Trommelmusik und beim Jazz. Ausnahmen sind lediglich die Jazz-Spielarten Bebop und Free Jazz.
Vielleicht ist der Begriff "Balkanjazz" ein Versuch, diesen rassistischen Zuschreibungen zu entkommen. Dafür braucht es jedoch nicht nur einen neuen Begriff, der in Abgrenzung zu diskriminierenden Praktiken definiert werden muss, sondern auch eine adäquate Sprache. Diese Sprache, die für einen Dialog zwischen MigrantInnen und MehrheitsösterreicherInnen notwendig ist, kann nicht von der Tatsache absehen, dass durch den Multikulti-Wahnsinn World Music für den Westen zu einem gewinnträchtigen Marketingkonzept wurde. Allein in Wien haben sich in den letzten Jahren einige Plattenläden auf dieses Genre spezialisiert, und jedes Musikgeschäft mit einem durchschnittlichen Sortiment kann zumindest eine eigene Rubrik mit "World und Ethno" vorweisen. Gleichzeitig wird MigrantInnen weiterhin das Wahlrecht konsequent abgesprochen, und sie werden in den Medien als identitätslose SozialschmarotzerInnen diffamiert, die den ÖsterreicherInnen ihre Ressourcen streitig machen.
Aber ein Ärgernis kommt selten allein. In der Jänner-Ausgabe der Musikzeitschrift Spex erfuhr ich, warum Pop im Jahr 2004 langweilig, unsexy und bieder wurde. Diesmal ist jedoch nicht die Rede von Geistern, sondern von Frauen. Für den Spex-Autor Christian Terzic ist es eindeutig, wer für die neue "Pop-Biedermeierei" verantwortlich ist. Es sind Pop-Ikonen wie Madonna, Cher oder Britney Spears. War den Musikerinnen früher kein Rock zu kurz und keine Bühnenshow zu provokativ, so sind sie heute nichts weiter als verheiratete Hausmütterchen, die in geblümten Kleidchen aus selbstverfassten Kinderbüchern lesen. Dass der Zusammenhang von Performance, Style und Musik ein Grundpfeiler der Popkultur ist, muss hier nicht weiter diskutiert werden. Wesentlich ist, dass sich Terzic, ohne auch nur einmal zu zögern, ausschließlich auf das Styling und die Körper der Frauen konzentriert. Ihre Musik bleibt unerwähnt. Dieser Artikel zeigt, dass der so genannte "Popfeminismus" an der Repräsentation von Musikerinnen in den deutschsprachigen Musikmagazinen auch 2005 nur wenig ändern wird. Womit wir wieder beim Thema wären: Die rassistischen Diskurse über Popmusik verlaufen entlang der Einteilung in "Orient" und "Okzident", in der implizit die Konzeptionen von Weiblichkeit und Männlichkeit enthalten sind. Indem Terzic die Popmusikerinnen auf ihre Körperlichkeit und ihr Styling reduziert, rangieren sie auf der gleichen Stufe wie "die Anderen". Wer den Stellenwert der "Anderen" einnimmt, ist variabel. Mal sind es die "Geister des Balkans" und die "Geister Afrikas", mal die Popmusikerinnen. Weiße Männer aus dem "Okzident" sind es wohl kaum.
Rosa Reitsamer ist Soziologin und DJ, lebt und arbeitet in Wien.