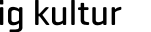Die Neuverteilung der Teilnahme. Antirassistische Politik und Kunstpraxis
Statt Dissens existiert heute nur ein Zustand, in dem Konflikt unsichtbar ist. Es scheint jeweils keine andere Lösung zu geben außer der, die gerade präsentiert wird. Und wenn es zu einer Auseinandersetzung zwischen “Parteien” kommt, dann eher um die Wege, wie diese für alle geltende Lösung zu erreichen ist.
Um Missverständnisse zu beseitigen: Ich schreibe hier nicht über die Techniken der Beurteilung bestimmter Kunstwerke, ich schreibe auch nicht über die Konfliktsituationen von Interessen einerseits und Werten andererseits. Mir geht es darum, daran zu erinnern, dass Ort und Gegenstand und letztendlich auch die Subjekte, die wir so selbstverständlich unter die Begriffe MigrantInnen, KünstlerInnen, Kunstprojekte usw. subsumieren, strittig sind. Wenn wir von antirassistischer Kunst reden wollen, scheint es mir notwendig, eine grundsätzlichere Ebene anzuschneiden. Das ist die Ebene des Streites über den Gegenstand des Streites. Und ich schreibe hier nicht über die “Politisierung” der Kunst, sondern über Kunst als Politik.
Konsens ist das, was den Dissens unterdrückt, sagt Rancière (1997, S. 803). Die KünstlerInnen (die ich übrigens als Funktionen einer Institution namens “Kunst” denke und nicht als reale Personen) sind innerhalb des österreichischen Nationalstaates diejenigen, die dazugehören. Sie sind nicht willige VollstreckerInnen, sondern diejenigen, die an der Schaffung des gesellschaftlichen Stimmungsbildes partizipieren. Was im Milieu der Kunst gezeigt und verhandelt wird, bleibt nicht folgenlos. Die Rolle der KünstlerInnen in einem vollständig durchbürokratisierten System ist es, Einfluss zu nehmen auf das, was die Arbeit der “Gesetzhüter” bestimmt. Die Mehrheit der KünstlerInnen legitimiert mittels ihrer Kunstproduktion eine unserer gesellschaftlichen Situation angepasste, spezifische Art von Konsens; nicht eine zwischen KampfgefährtInnen oder zwischen gegnerischen Parteien, sondern eine Art von Konsens, die dazu beiträgt, dass sowohl die KampfgefährtInnen als auch die gegnerischen Parteien verschwinden.
Statt Dissens existiert heute nur ein Zustand, in dem Konflikt unsichtbar ist. Es scheint jeweils keine andere Lösung zu geben außer der, die gerade präsentiert wird. Und wenn es zu einer Auseinandersetzung zwischen “Parteien” kommt, dann eher um die Wege, wie diese für alle geltende Lösung zu erreichen ist. Die neuen ReformerInnen, alle diejenigen, die andauernd von Reformen reden, charakterisiert vor allem eins: sie setzen sich für eine andere Gesellschaft ein, allerdings nur unter der Bedingung, dass diese die alte bleibt. Das ist der Konsens, den BUM (2004, 17) “Normalität” genannt hat. Und dazu haben wir hinzugefügt, dass die allererste Aufgabe der antirassistisch denkenden/handelnden Individuen und Gruppen diejenige des Begreifens und der Zerstörung dieser Normalität ist. Diese Zerstörung findet statt, indem auf die identifizierbaren Antagonismen in unseren Gesellschaften hingezeigt wird, und zwar in einem konkreten politischen Akt, in dem die Antagonismen aufgebaut und transformiert werden.
Die spezifische Qualität der Beziehungen von KünstlerInnen und MigrantInnen kann mit Rancière als “das Unvernehmen” bezeichnet werden. Der Begriff beschreibt einen bestimmten Typus von Situationen, in dem alle Teilnehmenden wissen, dass es den/die Andere(n) gibt, gleichzeitig aber nicht vernommen wird, was der/die Andere sagt. KünstlerInnen und MigrantInnen sind einander nicht fremd, weil sie etwas Gegenteiliges behaupten und vertreten. Die KünstlerInnen sagen nicht “weiß” und die MigrantInnen “schwarz” (oder selten umgekehrt). Ganz im Gegenteil: Wir haben hier eine Situation, in der beide soziale Funktionen das gleiche sagen, zum Beispiel sich über die Gleichheit zu verständigen versuchen; und trotzdem wird das, was MigrantInnen sagen, in der Institution Kunst nicht wahrgenommen. Die hier angesprochenen zwei Funktionen unserer Gesellschaften verstehen einander und verstehen einander nicht, auch wenn sie dieselbe Einstellung haben. Dahinter steht die Situation der Sprechenden selbst, und die ist nicht “gleich”. Innerhalb dieser Situation wird die Ungleichheit und die Wahrnehmung dieser Ungleichheit strukturiert.
Antirassismus beginnt genau dort, wo die beschriebene Art von Konsens in Frage gestellt wird, wo genau dieser permanente Versuch, Gewinne und Verluste anzugleichen, seitens der Anteillosen in Zweifel gezogen wird (und zwar nicht, indem sie die ihnen zur Verfügung gestellte Position dankbar annehmen, sondern indem sie eine Position erobern, diejenigen, die bis jetzt dort waren, verdrängen, also eine politische, und nicht eine moralisch-humanistische Auseinandersetzung führen).
Unsere Gesellschaft ist verteilt in Körper, die gesehen werden und in solche, die nicht gesehen werden. Die Stimmen der einen werden als Argumente gehört und diejenigen der anderen als Lärm wahrgenommen; ein Lärm, dessen Funktion darin besteht, Emotionen zu signalisieren. Die MigrantInnen sprechen nicht, sondern lärmen, weil sie “Wesen ohne Namen” sind. Sie sind nicht eingeschrieben in die Gemeinschaft, sondern werden, als anwesend aber nicht dazugehörig verwaltet, als diejenigen, die auf der untersten situativen Ebene andauernd gefragt werden, woher sie denn kommen und bei denen man/frau sich andauernd wundern muss, wie gut sie “Deutsch” sprechen.
Antirassistisch zu denken heißt in dieser Situation, eine Ebene hinzuzudenken, die geschaffen werden muss, um überhaupt von einem sprachlichen Austausch reden zu können. Solange es diese Ebene nicht gibt, besteht auch keine Kommunikation. Wo es keine Kommunikation geben kann, existiert auch keine Gegnerschaft und folglich kein Dialog, um diese zu überwinden. Was die MigrantInnen mit ihren Handlungen, auch mit ihrem Widerstand, machen, ist, ihre Namen in die symbolische Ordnung der Gesellschaft einzuschreiben. Das heißt, sie betreiben nicht Kommunikation, sondern versuchen, das Dispositiv zu verändern, durch das geregelt wird, was in unseren Gesellschaften als Kommunikation gelten kann.
Eine Handlung ist politisch, wenn der Gedanke der Gleichheit in eine Gemeinschaft eingeschrieben wird. Dies ereignet sich in einem Streit. Insofern besteht ein Gegenüber. Politisch heißt hier, dass sich zwei unterschiedliche Positionen begegnen. Diejenigen der allgemeinen Ordnung, der Verwaltung einerseits und diejenigen der Gesamtheit der Praktiken andererseits , die von der Annahme der Gleichheit geleitet sind (Rancière 2002, 42). Eine politische Handlung kann nur eine Handlung im Konflikt sein. Insofern ist jede politische Handlung durch einen Konflikt charakterisiert, nicht aber ist umgekehrt jeder Konflikt eine politische Handlung. Nur jene Konflikte, die sich am Prinzip der Gleichheit orientieren, sind politische Konflikte. All jene Konflikte, die mittels Mediation und dergleichen gelöst werden können, sind keine politischen Konflikte.
Kunst ist nicht an sich politisch. Ganz im Gegenteil, indem die großen Kämpfe um die Institution Kunst des letzten Jahrhunderts abgeflaut sind, scheint die Kunst ein Bereich der Bestätigung geworden zu sein, eine Bestätigung dessen, was die Verwaltung vorgibt. Kunst ist erst dann politisch, wenn sie sich in die politischen Konflikte einmischt, sie inszeniert, vorantreibt oder einfach den Raum für deren Inszenierung bereit stellt.
Kunst ist eben nicht politisch, wenn sie “Kommunikation fordert”, sondern wenn sie die Herrschaftsformen zu verändern trachtet; nicht wenn sie die Verhältnisse erklären/verstehen will, sondern wenn sie die konkreten Formen der Ausbeutung zu sprengen versucht. Kunst ist dann antirassistisch, wenn die Herrschaftsverhältnisse, die den gesellschaftlichen Platz der MigrantInnen bestimmen, thematisiert werden, und gleichzeitig versucht wird, diese zu verändern oder zumindest neu zu ordnen. Künstlerisch-politische Interventionen, z.B. diejenigen die auf den Nationalstaat abzielen, sind deswegen möglich, weil der Staat ein Effekt ist, der aus Einrichtungen besteht, die alles andere als gleichförmig sind. Diese Einrichtungen sind selbst Produkte von sozialen Kämpfen.
Jede politische Subjektivierung zieht eine Ent-Identifizierung mit der gesellschaftlich vorgegebenen Ordnung nach sich. Gewissermaßen handelt es sich dabei um das Eröffnen eines Raumes, in dem sich jede(r) dazuzählen kann. Die migrantische politische Subjektivierung ist keine Form der “Kultur”, wie dauernd seitens der gouvernementalen Akteure vorgegaukelt wird. Sie ist auch keine zufällig entstandene Ansammlung von Menschen, verglichen mit auf einen Bus wartenden Fahrgästen. Das Gegenteil ist der Fall: der migrantischen politischen Subjektivierung geht (statt der behaupteten Homogenisierung en bloc) eine Vielfalt von Brüchen voraus. Diese Brüche trennen die Körper von ihren Vorschreibungen. Diese Brüche ermöglichen, dass die Schicksale der MigrantInnen sich in die Erfahrung der Macht einklinken und dadurch zur politischen Schlagfertigkeit gelenkt werden.
MigrantInnen und KünstlerInnen führen keinen Dialog. Der Dialog gehört nicht zur Politik. Einen Dialog - mitsamt dem dafür vorgesehenen Verb “verstehen” - dauernd als die politische Lösung anzubieten, unterstellt nur, dass es manche unter uns gäbe, die wüssten, um was es geht und dass andere “einbezogen” werden müssten, heißt sie dazu verpflichten, dem Bestehenden zuzustimmen. “Dialog” besteht vor allem aus dieser Lüge. Der Dialog und all jene, die den Dialog fordern, gehören zur Ideologie des Bestehenden, d.h. zu den rassistischen Herrschaftsverhältnissen. Politik beginnt (und endet) vor jeglichem Dialog und zwar im Streit um dessen Bedingungen; im Streit um die Gültigkeit des Bestehenden, dessen Funktionsweisen sich u.a. im Dialog vollziehen. Wir, die Teil-nehmenden und die Anteillosen sprechen die gleiche Sprache, trotzdem gelangen die Worte einiger von uns als Vernunft (Befehl) und die der anderen als Emotion (Gehorsamkeit) an die Öffentlichkeit. Diese unmögliche Form der Beziehung verhindert jegliche Kommunikation.
Der anscheinend empirische Charakter der Integration mit ihrer Aufteilung der Bedürfnisse und Funktionen ist ein Versuch, die Paradoxie der Migration als anteilloser Teilnahme zu beseitigen: die MigrantInnen werden in ihre Glieder zerlegt, damit das Gemeinsame des Nationalstaates wieder zusammengesetzt werden kann. Darum die besondere Sorge der Machthabenden (Verwaltung, SozialwissenschafterInnen, KünstlerInnen usw.) um die migrantischen Frauen, um die “Zweite Generation” usw. Grundsätzlich dabei ist, dass die Strategie ihr Vorbild im III. Buch von Platons “Staat” hat. Dort wird die gesamte Gemeinschaft so zerlegt, dass es keinen gemeinsamen Raum für Ausverhandlung, für den Streit mehr gibt. Jede(r) hat seine/ihre Funktion. Ähnlich scheint die Vorgangsweise gegenüber der Zersetzung des migrantischen Körpers zu sein. Jedem/jeder soll geholfen werden, “selbstbestimmt” marktwirtschaftlich zu funktionieren. Nur die Rechtfertigungen haben sich dieses Mal geändert. Es geht um Hilfe, und nicht mehr um Utopien. Die Hilfe als Machtkategorie hat das Ideal einer Endgültigkeit des Funktionierens in der zerlegten Gemeinschaft abgelöst. Das hat sich in unseren Gesellschaften geändert. Das unterscheidet uns von der Antike.
Warum ist die Problematik der Migration so wichtig? Weil mit MigrantInnen als politische Subjektivierung etwas Sichtbares ins Feld der Erfahrung tritt, durch das das Regime des Sichtbaren verändert wird. Dieses Sichtbare ist mit Rancière (2002, 109) gesprochen eine Einrichtung der Subjekte, die nicht mit den Teilen des Staates oder der Gesellschaft übereinstimmen, von Subjekten, die jede Repräsentation der Plätze und Anteile in Unordnung bringen. Weil sie weder einen Platz noch einen Anteil mit anderen teilen. Das Sichtbare tritt ein in einen Ort des Austragens des Streits. Der Streit besteht nicht darin, Interessenkonflikte zu bereinigen. Es gibt keine PartnerInnen und GegnerInnen in diesem Streit, insofern können wir nicht von einem Dialog/ Diskussion oder Gegnerschaft der schon an der Verwaltung beteiligten Subjekte reden, sondern nur von einer Feindschaft (weil unvereinbar bis zur Veränderung).
Die MigrantInnen sind eine Gemeinschaft spezifischen Typs, entstanden in der spezifischen Situation der kapitalistischen Gesellschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, und sie stellen durch ihre Anwesenheit bestimmte Funktionsweisen der nationalstaatlichen Verwaltung in Frage. Die Permanenz dieser Frage führt zur Bestätigung als politisches Subjekt.
Wenn die MigrantInnen ihre Forderungen aufstellen, dann heißt es, dass sie diese Subjektivität sind, die nicht mit den Teilen des Staates oder der Gesellschaft übereinstimmt, und sich in einem Streit und dessen Austragung befinden. Es handelt sich dabei um keinen Interessenkonflikt, weil die MigrantInnen in diesen unseren Gesellschaften und Strukturformationen kein Interesse als Verwaltungssubjekte anmelden können. Sie haben kein Wahlrecht. Um diese Strukturformation geht es, um ihren Charakter, der die Teil-nahme aller ausschließt. Es geht darum, diese Teil-nahme neu zu verteilen. Das was ausgeschlossen wird, ist nicht ein Draußen-Sein. Es ist nur eine bestimmte Aufteilung des Gleichen. Und weil wir alle eingeschlossen sind, besinnen wir uns auf das Politische, das nicht Konsens, sondern nur Dissens heißen kann.
Noch einmal am Ende: MigrantInnen und KünstlerInnen sehen sich in gegenüberliegenden gesellschaftlichen Positionen bezüglich der Rationalität ihrer Sprechsituation. Obwohl sie dieselben Worte haben, verstehen sie nicht dasselbe darunter. Der Begriff “Gleichheit” heißt für beide Funktionen in unseren Gesellschaften etwas anderes. Dies beruht nicht auf dem Verstehen der “kulturellen Unterschiede” oder auf Missverständnissen in der Kommunikation. Vielmehr geht es um etwas viel Fundamentaleres, um die Situation der Sprechenden selbst. Die Frage dabei lautet, was es heißt, ein/e KunstproduzentIn zu sein, um etwas politisch auszudrücken? Die KunstproduzentInnen sind nicht politisch, weil die Politik unvermeidlich und ein notwendiger Bestandteil unserer Erfahrung wäre. Sie sind es, wenn die Beziehung zur Politik, zu einem bestimmten oben skizzierten Verständnis der Politik als Dissens um die Teile der Gemeinschaft, als Notwendigkeit erscheint, spezifische künstlerische Positionen zu definieren.
Literatur
Büro für ungewöhnliche Maßnahmen - BUM (2004), Unser kleines Jenseits. Das Wir und der Antirassismus. Ein Beitrag zur antirassistischen Arbeitspraxis, in: BUM (Hg.), Historisierung als Strategie. Positionen - Macht - Kritik, Wien.
Jaques Rancière (2002), Das Unvernehmen. Frankfurt am Main
Jaques Rancière, Jean-Francois Chevrier, Sophie Wahnich (1997), Die Demokratie als politische Form, in: Politics-Poetics, Cantz, 800-804
Ljubomir Bratic ist Philosoph und Leiter des BUM - Büro für ungewöhnliche Maßnahmen in Wien.