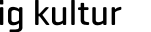Die Repolitisierung des Flüchtlingsschutzes. Ein Interview mit Migrationsexpertin Judith Kohlenberger.
Während 2015 schnell die Flüchtlingskrise ausgerufen wurde, findet der Begriff heute noch kaum Verwendung, obwohl bereits nach wenigen Wochen mehr Menschen aus der Ukraine in die EU geflohen sind, als in den Jahren 2015 und 2016 zusammen. Woran liegt das? Könnte die Stimmung wieder kippen? Ein Gespräch mit Migrationsexpertin Judith Kohlenberger darüber, was nun besser funktioniert, wieso aber das Thema Asyl weiter politisiert und die Flüchtlingskonvention aufgeweicht wird.

Patrick Kwasi: 2015 wurde die sogenannte Flüchtlingskrise plötzlich zum Begriff und blieb jahrelang ein Politikum, von dem rechte Parteien auch massiv profitieren konnten. Als Folge des Ukraine-Kriegs sind innerhalb kurzer Zeit mehr Geflohene in der EU angekommen als 2015 und 2016 zusammengerechnet, aber von einer Flüchtlingskrise spricht noch niemand. Woran liegt das?
Judith Kohlenberger: Einerseits hat man doch aus 2015 und den Folgejahren gelernt und versucht den Begriff „Krise“ zu vermeiden. Das betrifft auch Worte wie „Welle“, „Flut“, „Strom“, rhetorischen Bilder wie „überrollt werden“ und ähnliches. Andererseits hat eine Differenzierung Einzug gehalten: Man unterscheidet nun zwischen Flüchtlingen und Vertriebenen. Das wird uns noch länger befassen, da sich die Frage stellt, wie lange die Vertriebenen bleiben dürfen, denn sie erhalten nur temporären Schutz. Für jene, die dauerhaft in der EU bleiben möchten, muss es auch für die Zeit danach Lösungen geben. Dann wären wir aber wohl wieder im Bereich des Asylrechts. Die Unterscheidung ist teils auch eine politstrategische, weil man den Begriff „Flüchtling“ in den letzten Jahren negativ besetzt hat. Hier ist es zur in der Forschung als „Crimigration“ bezeichneten Kriminalisierung von Migration gekommen. Darauf hat man viel politische Energie verwendet und nun kann man schwerlich über Nacht eine 180 Grad Drehung machen und pro Flüchtlingsaufnahme sein. Auch deshalb braucht es andere Begrifflichkeiten, damit sich diese Kehrtwende argumentativ ausgeht.
Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie man diese problematische Differenzierung sinnvoll thematisieren kann. Wie man auf das hinweisen kann, was an den EU Außengrenzen immer noch passiert, was an anderen Grenzübergängen Polens mit syrischen und afghanischen Flüchtlingen passiert, nämlich dass Leute immer noch im Sumpfgebiet sterben – ohne dass dieser Hinweis auf Kosten der ukrainischen Ankommenden geht. Denn ob sie nun im SUV kommen oder kaum von der Grundversorgung leben können, sie alle mussten als Flüchtlinge um Leib und Leben fürchten.
Patrick Kwasi: Worin unterscheidet sich die Situationen von Geflohenen aus Syrien und aus der Ukraine und worin unterscheidet sich die Wahrnehmung?
Judith Kohlenberger: Es unterscheidet sich gar nicht so sehr. Wenn ich in einem der Ankunftszentren stehe, dann fühle ich mich unmittelbar nach 2015 zurückversetzt. Da war anfangs die Stimmung eine sehr ähnliche. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Begriff „Willkommenskultur“ nicht von ungefähr genau damals geprägt wurde. Was aber anders ist und weshalb es relativ rasch Verfallserscheinungen der Solidarität gab: Damals hat die Politik nicht mit einer Stimme gesprochen. Das offizielle Österreich hat lange herumgedruckst, um schlussendlich einfach das zu tun, was Deutschland tat, während manche Mitglieder der österreichischen Bundesregierung quergeschossen haben, um daraus politisches Kleingeld zu schlagen. Da ist man heute geeinter.
Außerdem hat sich die Europäische Union dieses Mal schnell und unbürokratisch dazu entschlossen, die Massenzustromrichtlinie zu aktivieren. Man hat erkannt, dass andernfalls die Asylsysteme in den angrenzenden Ländern wie Polen oder Ungarn schnell überlaufen wären. Wenn es zur Überlastung dieser Systeme kommt, steigt der Unmut in der Bevölkerung, das stärkt auch spalterische Tendenzen. Das hatte man 2015 leider nicht im Blick.
Patrick Kwasi: Was sagt diese Richtlinie?
Judith Kohlenberger: Die Richtlinie besagt, dass Ankommende kein Asylverfahren durchlaufen müssen, sondern sofort nach der Ankunft temporären Schutz für die Dauer von maximal zwei bzw. drei Jahren gewährt bekommen. In Österreich muss das alle sechs Monate neu beantragt und verlängert werden. Einer der Kritikpunkte vieler Expert*innen ist, dass die konkrete Umsetzung der Richtlinie bei den Mitgliedsstaaten liegt. Die Ausgestaltung unterscheidet sich somit stark von Land zu Land. In den Niederlanden etwa wird die Richtlinie auch auf nicht-ukrainische Staatsbürger*innen angewandt, die in der Ukraine aufhältig waren, beispielsweise Studierende aus dem globalen Süden. In Österreich ist die Unterscheidung zwischen diesen beiden Gruppen deutlicher und Menschen ohne ukrainischen Pass bekommen keinen temporären Schutz. Grundsätzlich ist aber zu begrüßen, da zumindest Ukrainer*innen sofort wissen, dass sie bleiben und sofort arbeiten dürfen, Grundversorgung bekommen und nicht diese unsäglich langen Asylverfahren durchlaufen müssen.
Patrick Kwasi: Das gab es 2015 noch nicht oder ist nicht so zur Anwendung gekommen?
Judith Kohlenberger: Das gab es damals nicht. Schon 2015 meinten einige Expert*innen, nun wäre ein geeigneter Fall, um die Massenzustromrichtlinie zu aktivieren, aber unter den damals noch 28 EU-Mitgliedsstaaten war eine Einigung unmöglich. Damals war man noch viel gespaltener, die EU weniger geschlossen und schlechter vorbereitet. Es war politisch nicht durchsetzbar. So wie sich die Situation damals dargestellt hat, hätte man die Richtlinie allerdings schon aktivieren können.
Patrick Kwasi: Es klingt mal gut, dass die Leute nicht so lange um Ungewissen bleiben, es klingt aber auch danach, dass man sich die Möglichkeit offen hält, dass man Leute nicht annehmen muss, auch nicht, wenn sie aus einem Kriegsland kommen und nach der Konvention offensichtlich Anspruch auf Asyl hätten, sondern sie sozusagen mit „Kurzabos“ abspeisen kann und sie dann jederzeit wieder rauswerfen kann, wenn man politisch befindet, dass die Situation sich gebessert habe. Hat das Ganze nicht einen Haken?
Judith Kohlenberger: Das ist tatsächlich eine häufige Interpretation, die ich zu einem großen Teil auch unterschreiben würde. Sie ging in dieser Anfangseuphorie ein wenig unter, weil man sich gefreut hat, dass die Massenzustromrichtlinie aktiviert wurde und alle Schutz erhalten, die ihn brauchen. Es ist jedoch von der Qualität des Schutzes nicht dasselbe wie der internationale Schutz, den das Asylrecht zuspricht. Der temporäre Schutz basiert auf dem Gutdünken der EU, der Europäischen Kommission und der Mitgliedsstaaten. Wenn die EU beschließen würde, das Herkunftsland sei jetzt sicher, dann gilt der temporäre Schutz nicht mehr und dann gibt es keine Rechtssicherheit mehr.
In der Forschung bezeichnet man das als „Repolitisierung des Flüchtlingsschutzes“, wie man es in der Zeit des Kalten Krieges gehandhabt hatte, als westliche Staaten strategisch Menschen aus den Ostblockstaaten und der Sowjetunion aufgenommen haben, weil damit indirekt Politik getrieben wurde. Man wollte so Dissidenten und Oppositionelle stärken, weil es einem politisch entgegenkam. Damit setzt man aber einen Kontrapunkt zum universalen Flüchtlingsschutz, der unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht und so weiter zu gelten hat. Das ist im öffentlichen Diskurs nun nicht der Fall. Da wird betont, wie ähnlich die Vertriebenen uns wären, dass es ja größtenteils Frauen und Kinder seien — wobei es bei dem Argument ja nie um Frauen und Kinder geht, sondern um jene, die man eben nicht haben möchte.
So eine Form der Aufnahmebereitschaft steht auf tönernen Füßen. Was, wenn irgendwann auch ukrainische Männer nachkommen? Was, wenn deren Hautfarbe eine andere ist? Es gibt auch viele Roma und Sinti in der Ukraine, die kommen wollen. Da spürt man schon Widerstände bei den Europäischen Mitgliedsstaaten beim Gedanken, die aufzunehmen. Auch Menschen aus Afghanistan, die in der Ukraine im Asylverfahren waren, fliehen nun von dort. Solch eine Differenzierung ist also schwierig und ich befürchte, dass sie sich verstärken wird.
Patrick Kwasi: Es könnte auch eine Möglichkeit sein, ein System, das nicht funktioniert weiterlaufen zu lassen. Man hat keinen Bedarf mehr ein System zu reparieren, in dem Asylverfahren ewig dauern, wenn man die Möglichkeit hat, sie immer wieder bürokratisch kurzfristig zu verlängern, um sie dann doch noch schnell loszuwerden.
Judith Kohlenberger: Man schafft im Grunde immer spezielle Schutzkategorien für bestimmte Gruppen und entfernt sich immer weiter von der Idee des universalen Schutzes. Das ist auch eine Art von Rückschritt. Im Anlassfall ist es eine schnelle unbürokratische Maßnahme, aber auf längere Sicht braucht es weiterhin den globalen Flüchtlingsschutz, wie er in der Genfer Konvention festgelegt ist. Den sollte man nicht untergraben, denn das ist sicher nicht die letzte Fluchtbewegung, die Europa bewältigen muss. Aufgrund der Getreideausfälle durch den Krieg in der Ukraine wird eine Nahrungsmittelknappheit im globalen Süden erwartet, weshalb es zu Sekundärbewegungen kommen wird, die wohl vorerst Binnenbewegungen sein werden, aber irgendwann auch transkontinental stattfinden können. Und die Klimakatastrophe wird nicht so angegangen, wie es notwendig wäre, um Fluchtbewegungen zu verhindern. Für klimabedingte Flucht bietet die jetzige Form des Flüchtlingsschutzes aber keine Antworten.
Patrick Kwasi: Es gibt das Narrativ, dass 2015 alles gut war und alle helfen wollten und dann ist die Stimmung gekippt. Wie siehst du das?
Judith Kohlenberger: Ich sehe das differenzierter. Es klingt sehr danach, als hätten sich alle Menschen in Österreich um 180-Grad gewandt, nach der Kölner Silvesternacht oder als man die Balkanroute „geschlossen“ hat. Es gab auch danach viele Menschen in Österreich, die weiterhin aktiv waren in der Flüchtlingshilfe, pro Asyl waren, sich auf allen Ebenen in NGOs, in der Freiwilligenarbeit und in Vereinen engagiert haben. Viele Vereine wurden neu gegründet, die es bis jetzt gibt. Es gab aber auch freiwillige Helfende in Österreich, und in anderen Ländern wie Griechenland, die massiven Angriffen ausgesetzt waren, weil es irgendwann nicht mehr gesellschaftlich angesehen war, sich in der Flüchtlingsaufnahme zu engagieren. Helfende in Tirol haben mir erzählt, sie hätten das nicht mehr ausgehalten. Die haben dann begonnen, statt mit Flüchtlingen mit Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen zu arbeiten. Das ist auch wichtig, aber es ist dennoch tragisch, dass man nicht mehr öffentlich oder gar in der eigenen Familie sagen konnte, dass man sich für Geflüchtete einsetzt.
Trotzdem ist das nur teilweise passiert. Insgesamt kam es zu so etwas einer „Refugee Fatigue“, parallel zur „Pandemic Fatigue“. Nach der ersten, fast euphorischen Hilfsbereitschaft, aufgrund derer viele Menschen Gästezimmer zur Verfügung stellen oder man sich an den Hauptbahnhöfen einfindet, flacht die Kurve ab. Das ist menschlich gesehen verständlich. Die Hilfe erfolgt meist in der Freizeit, die meisten Menschen haben Brotberufe, denen sie nachgehen müssen. Man stumpft womöglich auch ab, bei dieser unmittelbaren Betroffenheit.
Dabei wäre es wichtig, dass auch staatliche Strukturen da sind, die nicht nur auf die Zivilgesellschaft setzen, sondern nach und nach übernehmen. Wenn man von Beginn an die Unterbringung und Begleitung von Geflüchteten gut organisiert und nicht nur Bilder verbreitet, die Angst und Schrecken verbreiten, wenn man deutlich macht, dass es gut geordnet und strukturiert verläuft, dann schafft man eine Situation, die die Menschen nicht verängstigt, sondern sie weiterhin positiv gegenüber Flüchtlingsaufnahmen stimmt. Auch in den Mühen der Ebene.
Derzeit hilft auch, dass die Menschen, die ankommen, nicht mehr so lange warten müssen. In Asylverfahren waren und sind Schutzsuchende über Monate oder sogar Jahre zum Nichtstun verurteilt. Und man weiß ja, dass es selbst bei österreichischen Jugendlichen nicht gescheit ist, wenn sie den ganzen Tag nichts zu tun haben. Herumlungernde männliche Jugendliche in Gruppen führten bei der einheimischen Bevölkerung zu Skepsis und Ablehnung. Das kann man zum Teil verhindern, indem man die Leute arbeiten oder eine Ausbildung machen lässt.
Patrick Kwasi: Aber lassen sich Ressentiments nicht sowieso nutzen, entweder es sind faule Ausländer oder sie nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Ist der Ausdruck der „Flüchtlingsmüdigkeit“ nicht ohnehin ein Ausdruck dafür, dass zu viel auf die Zivilgesellschaft abgewälzt wird?
Judith Kohlenberger: Das könnte auch jetzt wieder passieren. Einerseits hat man aus 2015 gelernt, die Stadt Wien hat beispielsweise von Anfang an Train of Hope eingebunden, ihnen das humanitäre Erstankunftszentrum in der Engerthstraße überantwortet. 2015 war das anders, da hat sich Train of Hope zuerst alleine engagiert und erst spät hat die Stadt erkannt, was die können.
Ich habe dennoch den Eindruck, dass sich Helfende zunehmend alleine gelassen fühlen. Menschen in den Erstaufnahmezentren sollen dort nur den ersten Kontakt haben, sie werden dort aufgenommen, bekommen Erstversorgung, werden Covid getestet, etc. und dann durch die verfügbaren Strukturen weitergeleitet zur Registrierung, zum Erhalt der Blauen Karte und so weiter. Tatsächlich kehren viele von ihnen über Tage und Wochen zurück, die vermeintlichen Erstaufnahmezentren werden zu einer Art Tagesbetreuungszentrum, wo man warme Mahlzeiten und Hygieneartikel bekommt. Da erkennt man eine Lücke, die wohl auch deshalb entstanden ist, weil man viel stärker auf private Unterkünfte setzt. Private Quartiergeber sind aber nicht dazu ausgebildet mit traumatisierten Geflüchteten zusammenzuleben. Das geht ein paar Tage gut, da unterstützt man sie bei Behördengängen und formellen Dingen. Es kann dann aber vorkommen, wie in einem Fall, den ich kenne, dass die junge ukrainische Frau den ganzen Tag zuhause sitzt und nur noch weint. Das ist verständlich, doch private Quartiergeber stecken tagsüber in ihren Berufen, sind womöglich überfordert. Das schafft eine schwierige Situation für beide Seiten. Es bräuchte also Brücken- oder Anschlussangebote. Öffentliche Stellen scheinen das noch zu wenig im Blick zu haben.
Patrick Kwasi: Heißt das nicht auch, dass man in Österreich oder allgemein der EU offenbar noch immer kein Konzept hat, wie man damit umgehen soll?
Judith Kohlenberger: Ja, das würde ich unterschreiben. Vieles funktioniert besser, aber in manchen Bereichen läuft es sogar schlechter als 2015, wo man diese Brücken- und Anschlussangebote hatte. Damals waren die Menschen in großen Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, die ihre eigenen Schwierigkeiten mit sich brachten, aber es gab eine Tagesbetreuung und die Menschen mussten nicht überlegen, wo sie ihre drei Mahlzeiten am Tag herbekommen. Die Versorgung war unmittelbar nach der Ankunft sogar besser.
Für die jetzige Situation hat man noch keine langfristige Lösung gefunden. Auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen gehört verbessern. Es gibt noch viel Reibungsverlust zwischen Bund und Ländern, weil nicht klar ist, wer zuständig ist. Und man muss die Zivilgesellschaft arbeiten lassen und fördern. Es darf aber nicht sein, dass Train of Hope zu einer Art Dienstleister wird, den man mit dem beauftragt, was der Staat vorgibt. Train of Hope überantwortet die operative Betreuung von Geflüchteten, sitzt aber nicht in den Gremien, um mitentscheiden zu können.
Ein wirkliches Fazit wird man wohl erst in Jahren ziehen können. Jetzt gäbe es jedoch ein Zeitfenster, in dem man – anders als 2015 – auch die Geflüchteten selbst miteinbeziehen könnte. Man könnte Gremien schaffen, in denen sich Menschen, die das können und wollen, einbringen und so eine Stimme für ihre vertriebenen Landsleute sind. Dafür wäre jetzt der richtige Zeitpunkt.

Judith Kohlenberger ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und Migrationsforscherin. Seit Herbst 2015 arbeitet sie zu Fluchtmigration und Integration, unter anderem im Rahmen des Displaced Persons in Austria Survey (DiPAS), eine der europaweit ersten Studien zur großen Fluchtbewegung 2015, die mit dem Kurt-Rothschild-Preis 2019 ausgezeichnet wurde. Ihre Arbeit wurde in internationalen Journals veröffentlicht, darunter PLOS One, Refugee Survey Quarterly und Health Policy.
Am Institut für Sozialpolitik leitet sie derzeit mehrere Forschungsprojekte. Im Februar 2021 erschien ihr neues "Wir" bei Kremayr & Scheriau, im Sommer erscheint der neue Titel "Das Fluchtparadox".
Beitrag als Podcast: