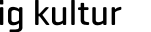Und keiner will’s gewesen sein … Antimuslimischer Rassismus in der Gegenwart
Die Themen Integration, Islam und Muslime sind aktuell allgegenwärtig. Dabei fallen in den Debatten immer wieder Schlagworte wie „Migrantenkids“, „Muslime“, „Türken“, „Parallelgesellschaft“, „fehlgeschlagene Integration“, „Integrationsverweigerer“ oder auch die in Zweifel gezogene „Demokratietauglichkeit“.
Die Themen Integration, Islam und Muslime sind aktuell allgegenwärtig. Dabei fallen in den Debatten immer wieder Schlagworte wie „Migrantenkids“, „Muslime“, „Türken“, „Parallelgesellschaft“, „fehlgeschlagene Integration“, „Integrationsverweigerer“ oder auch die in Zweifel gezogene „Demokratietauglichkeit“. Beschrieben wird damit meist „der Andere“: der Ausländer, Migrant, Nicht-Deutsche oder Nicht-Österreicher, die MuslimInnen. Diese Debatten gibt es nicht erst seit 9/11, aber sicherlich – im Zuge der diskursiven Rahmung sicherheitspolitischer Maßnahmen – verstärkt seit dieser Zäsur, und sie führen über Theo van Gogh, Attentate in Spanien und England, Kopftuchverbote, Marwa El-Sherbini, Ehrenmorde, Minarett- und Burka-Verbot, Einbürgerungstests u. v. m. bis hin zu den Geert Wilders, Thilo Sarrazins und Susanne Winters unserer Gegenwart. Doch worum geht es in diesen Debatten eigentlich, und warum reden die einen von Ängsten, Befürchtungen und Bedrohungsszenarien, die man ernst zu nehmen habe, und die anderen von antimuslimischem Rassismus?
Sprache schafft Realitäten
Um die Frage, ob es eine spezifisch auf MuslimInnen bezogene Form des Rassismus gibt, beantworten zu können, gilt es, den Blick auf die Produktion des „Anderen“ zu richten. Wie wurde „der Migrant“ zum Muslim, „der Muslim“ zum „Anderen“, „der Andere“ zum Gegenteil von „uns“ im Setting einer gefühlten Dichotomie von „wir“ und „sie“?
Sprache ist Macht, und Bezeichnungen und Begriffe konstruieren unsere Lebenswelten – wer wir sind, wie wir gesehen werden und als was wir uns selbst sehen. Gesellschaften sind unterteilt in mehrere Gruppen, zu denen man sich in unterschiedlichem Maße zugehörig fühlen kann oder deren Teil man ist – oder von denen man ausgeschlossen wird. Die Gruppe, die darüber entscheiden kann, ob ein Individuum oder ein Kollektiv Teil einer privilegierten – das bedeutet gesellschaftspolitisch möglichst gut situierten, über ungeschriebene Vorrechte verfügenden – Gruppe sein kann oder nicht, verfügt über Macht, vor allem in Bezug auf Sprache und deren Verwendung. Diese Gruppe – die Psychologin Brigit Rommelspacher bezeichnet sie und die von ihr ausgeübte symbolische Macht im Sinne eines Systems von Vor- und Darstellungsmustern als „Dominanzkultur“ – wird im Kontext der „Islam-Debatte“ von der Weißen Mehrheitsgesellschaft gestellt. Diese bezeichnet und spricht über „die Anderen“: die AusländerInnen, die MuslimInnen, die MigrantInnen, die Fremden, die, die sich nicht integrieren wollen, diejenigen also, vor denen „wir“ – auch eine konstruierte Gruppe – Angst haben müssen.
Es geht aber in diesen Debatten nicht nur um eine vermeintliche unvereinbare Differenz von Kulturen, sondern um deren Hierarchisierung, die mit Formen des gesellschaftlichen Ein- und Ausschlusses verbunden ist. Durch die „Anderung“ und Selbstpositionierung und ein damit verbundenes Vorstellungssystem wird Ungleichheit erst hervorgebracht. Die Konstruktion von hierarchisierter Differenz und Selbstpositionierung erfolgt über angebliche kollektive Zugehörigkeiten und Identitäten, die sich auf vermeintlich kulturelle Kriterien beziehen und als u. a. körperliche Zeichen konstruiert werden können.
Die als bedeutungsvoll konstruierten Zeichen, denen negativ empfundene Eigenschaften zugewiesen werden und die soziale Informationen übermitteln, lassen sich als Stigmata bezeichnen. Die Funktionsweise dieses stigmatisierenden Zeichensystems kann durch den Begriff der Wahrnehmbarkeit oder der Lesbarkeit noch verdeutlicht werden, wobei es sowohl körperliche (u. a. Haut- oder Haarfarbe oder ein Kopftuch) als auch nicht-körperliche Zeichen gibt (ein Akzent, ein bestimmter Name), die auf ein konstruiertes Anders-Sein hinweisen. Die Fähigkeit, die Zeichen zu decodieren bzw. zu lesen, ist in der Regel dadurch gegeben, dass die Sozialisation in einer Gesellschaft alle ihre Mitglieder mit den entsprechenden Deutungskompetenzen ausstattet. So steht z. B. inzwischen die kopftuchtragende Frau für Unterdrückung, die Darstellung einer Gruppe männlicher Jugendlicher mit sichtbarem migrationsgeschichtlichem Hintergrund für Gewaltbereitschaft und Bildungsferne oder die Bezeichnung „Migrant“ oder „Integrationsverweigerer“ für „Muslim“.
Ressentiments gegenüber MuslimInnen und als solche Markierte: Rassismus?
Rassismusforscher wie Robert Miles, Stuart Hall oder auch Étienne Balibar betrachten den Prozess der Stigmatisierung als Teil von Rassismus. Allerdings reden wir heutzutage selbstverständlich nicht mehr von biologischen „Rassenunterschieden“, sondern von der vermeintlichen Unaufhebbarkeit kultureller Differenzen und der Unvereinbarkeit verschiedener Kulturen und ihrer Lebensweisen. Diese Art von Rassismus wird auch Neo-, Kultur- oder differentialistischer Rassismus oder „Rassismus der Gegenwart“ genannt: Nicht mehr Natur, sondern Kultur fungiert als zentrale Differenzierungskategorie. Kulturen werden essentialisierend gedacht und hierarchisch angeordnet, indem vermeintlich kulturellen Merkmalen eine negative Bedeutung bzw. Eigenschaft zugeschrieben wird. Diese Merkmale fungieren als Erkennungszeichen einer bestimmten Gruppe, die so als natürlich und unveränderlich vorgestellt wird: eine konstante Entität.
In Bezug auf antimuslimischen Rassismus funktioniert „Muslimisch-Sein“ als Stigma, und dazu reicht mitunter schon ein arabisch oder türkisch klingender Name bzw. alles, was auf eine bestimmte „Herkunft“ deuten könnte – hier vor allem auch auf das Aussehen, das Nicht-Weiß-Sein bezogen. Die Sichtbarkeit eines Stigmas ist nicht an sich gegeben, sondern codiert – vor allem durch mediale Beiträge und Situationen im sozialen Alltag, in denen negative Schlagzeilen mit bestimmten Bildern verknüpft werden, z. B. ein Bericht über kriminelle Jugendliche mit Bildern von türkisch- oder arabischstämmigen jungen Männern, die Darstellung eines sozial benachteiligten Bezirks und das Bild einer Gruppe „migrantisch“ aussehender Menschen etc. Die Decodierung bzw. die Lesbarkeit dieser Bilder hängt von der Fähigkeit des Zielpublikums ab, diese zu entziffern. Basis dafür ist eine angenommene Übereinstimmung in Bezug auf das, was als „normal“ und als „abweichend“ in einer Gesellschaft erachtet wird.
Durch die Abgrenzung der Mehrheitsgesellschaft erfahren MuslimInnen und als solche Markierte spezifische Zuschreibungen, durch die sie zu TrägerInnen bestimmter kultureller Werte und Normen erklärt und auf bestimmte Charaktereigenschaften festgelegt werden. Diese befinden sich vermeintlich natürlicherweise in Einklang mit der ihnen zugewiesenen ethnisch-religiösen Zugehörigkeit, wie sie zum Beispiel die Assoziationskette „Kopftuch – Muslimin – Nicht-Deutsche/Nicht-Österreicherin – Araberin/Türkin – unterdrückte Frau – problematisch“ zeigt. Zugleich ermöglichen die Zuschreibungen eine als hierarchisch überlegen gedachte Selbstpositionierung als westlich, modern, emanzipiert und deutsch bzw. österreichisch.
Entsprechend gibt es eine konstruierte „Gruppe“ von MuslimInnen in Deutschland, Österreich, Frankreich etc., die sich aufgrund ihrer antizipierten Andersartigkeit von dem, was von der Mehrheitsgesellschaft als „normal“ erachtet wird, abhebt und stigmatisiert ist. Antimuslimischer Rassismus als Bezeichnung dieses Phänomens fasst die rassistische Diskriminierungspraxis der Mehrheit gegenüber einer Minderheit, die auf einer konkreten, negativ-stereotypen Haltung gegenüber MuslimInnen basiert und sich in stigmatisierenden Zuschreibungen und Handlungen manifestiert – unabhängig davon, ob sich die Person oder Gruppe als MuslimIn versteht oder nicht. Der Begriff „antimuslimischer Rassismus“ geht folglich über eine Darstellung genereller Ängste vor „dem Islam“ – wie der Begriff „Islamophobie“ sie unterstellt – hinaus und beschreibt die mit ihm verbundenen Praktiken als Folge rassistischer Stereotype.
How to get in? Die Mehrheitsgesellschaft unter sich
Welche Funktion kann ein solcher Rassismus in einer Gesellschaft haben? Zum einen bewirkt er, dass das Selbstbild als vereinheitlicht und als überlegen empfunden wird – die Fiktion einer homogenen Nation wird aufrechterhalten bzw. durch die narrative Performanz hergestellt. In einer mitunter als unsicher empfundenen globalisierten Welt mit sich schnell verändernden Lebenswirklichkeiten und Straßenbildern mag dies dem oder der Einzelnen Sicherheit suggerieren. Der Appell der Notwendigkeit zur Integration des Anderen suggeriert eine moralische Überlegenheit, die das Selbstgefühl stärkt. Irrelevant erscheinen in diesem Rahmen struktureller Rassismus, institutionalisierte Diskriminierung oder soziokulturelle Ausgrenzung, denn es geht ja schließlich darum, sich gegen einen ausbreitenden religiösen Fundamentalismus, gegen sexistische und fundamentalistische Verhaltensweisen, für die „der Islam“ angeblich steht, zur Wehr zu setzen. Die zugrunde liegende organische Vorstellung von Kultur und Gemeinschaft blendet gleichermaßen soziale Ungleichheiten und Machtsymmetrien aus, die Abwertung von als ethnisch und/oder religiös definierten Gruppen ist eine Aufwertungsstrategie der eigenen kollektiven Zugehörigkeit und manifestiert sich in der gesellschaftlichen Aufspaltung eines „wir“ und „sie“.
Eine andere mögliche Erklärung ist, dass antimuslimischer Rassismus eine Art Abwehrmechanismus der dominanten Mehrheitsgesellschaft darstellt. MigrantInnen, meist aus „bildungsfernen“ Schichten stammend, wurden überwiegend im Niedriglohnsektor beschäftigt. Solange sich auch die nachkommenden Generationen dort aufhielten, wurden sie auch nicht als Bedrohung wahrgenommen – bis die ersten Erfolge sichtbar wurden. Nun geht es um die gesellschaftliche Teilhabe und um Rechte, die eingefordert werden: im Sinne repräsentativer Gotteshäuser, im Bildungswesen, auf dem Wohnungsmarkt oder im Rahmen politischer Partizipation. Der Ausschluss von gesellschaftlichen Ressourcen wird nicht mehr ohne weiteres hingenommen, sondern es wird protestiert und Einspruch erhoben, repräsentiert von eigenen Organisationen und Bündnissen.
Komplexe gesellschaftliche Prozesse und Konflikte mit Hilfe der Kategorie „Islam“ oder „Muslime“ zu deuten, blendet soziale Faktoren nicht nur weitestgehend aus. Die soziale Hierarchisierung erfolgt über negative Zuschreibungen der vermeintlich natürlichen Wesensmerkmale, und ein fester, unbeweglicher Kulturbegriff wird verhandelt. Es ist gefährlich und bestürzend zugleich, dass nach den Geert Wilders, Thilo Sarrazins und Susanne Winters dieses Jahres Debatten über Integration, Einwanderung und Migration geführt werden – anstatt über diese aufkommende Welle von Rassismus, Diskriminierung und der Ethnisierung sozialer Ungleichheit zu sprechen und die gesellschaftliche Bereitstellung von Anerkennung, Gleichstellung und das Recht auf Differenz zu gewährleisten.
Ilka Eickhof hat Islamwissenschaft, Geschichte und Soziologie studiert, arbeitet zurzeit im Haus der Kulturen der Welt, Berlin, und beschäftigt sich sowohl akademisch als auch politisch mit Islam in Deutschland und antimuslimischem Rassismus.